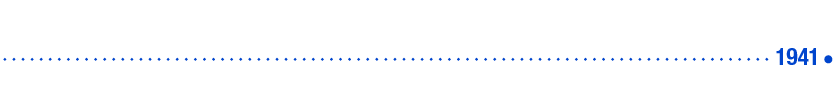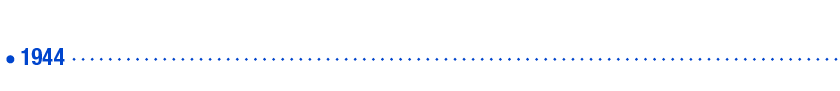Différences entre les versions de « Bruno Splitt »
m (Wurde mit Schaltfläche „Zwischenspeichern“ im Formular gespeichert) |
m (Wurde mit Schaltfläche „Zwischenspeichern“ im Formular gespeichert) |
||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|champBib=Reference | |champBib=Reference | ||
}} | }} | ||
|Resume_de=''Der kommunistische Widerstandkämpfer Bruno Splitt (1898-1981) ist eines der NS-Opfer, die man sicher nicht in der Psychiatrischen Klinik der RUS erwarten würde. Er war seit Beginn der 1920er Jahre in der Arbeiterbewegung des Ruhrgebiets aktiv. Zur Zeit der Machtübernahme führte er seine Tätigkeiten in veränderter Form im Untergrund fort und wurde in Reorganisationsphase der KPD eine zentrale Figur des kommunistischen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus in Essen. Unablässig den Repressionen des NS-Regimes ausgesetzt, führte sein Weg über insgesamt fünf Konzentrationslager schließlich ins KZ Natzweiler-Struthof im Elsass. Von dort aus wurde er zur augenärztlichen Behandlung in der Psychiatrischen Klinik der RUS aufgenommen, was zunächst erstaunt, aber aus reinen Sicherheitsgründen geschah. Bruno Splitt war einer von insgesamt 18 bis jetzt identifizierten Natzweiler-Häftlingen, die in der RUS behandelt wurden. Seine Biographie steht exemplarisch für diese ungewöhnliche Verbindung zwischen dem Konzentrationslager und der „Reichsuniversität“.'' | |||
|Contexte_de=Essen im Sommer 1933. | |||
„Weil ich aber bald merkte, daß ich festgenommen werden sollte, wurde ich flüchtig. [...] Ich hielt mich innerhalb des Stadtgebiets verborgen. Ich habe mal 8 Tage hier und mal 8 Tage dort gewohnt, es kann auch sein, daß ich manchmal an einer Stelle länger gewohnt habe.“ So schilderte der kommunistische Widerstandkämpfer Bruno Splitt seine Zeit im Untergrund. Viel mehr ist über diesen Lebensabschnitt Bruno Splitts aus den Quellen nicht zu erfahren – außer, dass er quasi seit dem Frühjahr 1933 wie viele seiner Genoss*innen ständigen Repressionen ausgesetzt war. Im Juni 1933 war ein Haftbefehl gegen ihn erlassen worden, sodass er jederzeit damit rechnen musste, festgesetzt zu werden. Ein Blick auf die Geschehnisse in Essen, eine Hochburg der Arbeiterbewegung im Ruhrgebiet, lässt erahnen, was das für ihn persönlich bedeutet haben muss. Der nationalsozialistische Terror nach der Machtergreifung manifestierte sich täglich aufs Neue. Vor Übergriffen, Gefangennahmen und Folter konnte keiner der organisierten Arbeiter*innen mehr sicher sein. Die Gefängnisse waren hoffnungslos überfüllt und viele verschwanden in den neu entstehenden KZs. In Bochum wurden mehrere KPD-Funktionäre in einer SA-Kaserne physisch misshandelt, schwerverletzt durch die Straßen geschleppt und schließlich dort in der Öffentlichkeit liegen gelassen. Auch vor Mord schreckte die SA nicht zurück: Nach der Zerschlagung der Gewerkschaften am 2. Mai 1933 fanden Spaziergänger*innen die Leichen von vier Funktionären des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbunds im Wasser. Damit seien nur einige wenige Beispiele genannt, die die Realität des Terrors widerspiegeln. Der gewaltvolle Umgang der Gestapo mit verhafteten Genoss*innen dürfte Bruno Splitt sicher nicht verborgen geblieben sein und muss mit den fortwährenden Repressionen eine psychisch höchst belastende Atmosphäre der Angst geschaffen haben. Diese Situation spitzte sich im Oktober 1933 noch erheblich zu, als von der Polizei in Essen im großen Umfang Fahrradkontrollen durchgeführt wurden, bei denen sich die betreffende Person ausweisen musste. Um Bruno Splitt eine falsche Identität zu verleihen und damit vor der drohenden Verhaftung zu bewahren, übergab ihm seine Frau Hedwig den Militärpass seines Bekannten mit dem Namen Fritz Kleta (geb. 1.02.1895 in Berlin-Steglitz, - ?). Dies konnte Bruno Splitt jedoch nicht schützen, er wurde in Essen-Bottrop im Dezember 1933 festgenommen. Die Polizei fand den Ausweis bei ihm, den er wohl nicht verwendet hatte. Es ist denkbar, dass die Polizei genau wusste, wie der Gesuchte aussah – die entsprechende Akte enthält ein ziviles Passfoto von Bruno Splitt. | |||
Arbeiterbewegung und kommunistischer Widerstand in Essen | |||
Bruno Splitt wurde am 4. September 1898 in Graudenz (damals Westpreussen, heute Polen) als Sohn des Schuhmachers Ernst und dessen Ehefrau Pauline Splitt geboren. Über seine Kindheit ist fast nichts bekannt. Von 1907 bis 1912 besuchte er die Grundschule, vermutlich in seinem Geburtsort. Danach zog er nach Essen. Dort angekommen, war Bruno Splitt zuerst als Laufbursche und dann als Lagerist bei der Firma Grubenbecker beschäftigt. Von 1916 bis 1917 arbeitete er als Presser bei der Firma Thyssen. Vom September 1917 bis Juli 1919 war er zum Heeresdienst eingezogen, vom Januar 1918 bis 9. April 1918 befand er sich an der Westfront. Bei den langen Märschen traten gesundheitliche Probleme an seinen Füßen auf und er wurde zurück nach Deutschland zum „Landsturm“ in Schlettstadt im Elsass (heute frz. Sélestat) versetzt. Nach Ende des Ersten Weltkrieges und der Demobilisierung arbeitete er zunächst in einer Kohlefabrik in der Nähe der Essener Zeche Wolfsbank. Er war zusammen mit Ernst und Emil Splitt in der Germaniastraße 71 in Essen gemeldet. Bei erstgenanntem handelt es sich definitiv um seinen Bruder, bei zweitgenanntem ist dies ebenso denkbar. In dieser Zeit engagierte Bruno Splitt sich erstmals politisch. Er organisierte sich 1919 gewerkschaftlich im „Bergarbeiterverbund Deutschland“ und trat im Oktober 1920 der USPD bei, um nach deren zunehmenden Verfall und Machtverlust der neu gegründeten KPD anzugehören. Bruno Splitt war danach mehrfach bei der Firma Krupp in Essen beschäftigt (Abb. 2). | |||
|etatEn=Draft | |etatEn=Draft | ||
|etatDe=Entwurf | |etatDe=Entwurf | ||
|etatFr=Brouillon | |etatFr=Brouillon | ||
}} | }} | ||
Version du 6 octobre 2021 à 11:25
| Bruno Splitt | |
|---|---|
| Prénom | Bruno |
| Nom | Splitt |
| Sexe | masculin |
| Naissance | 4 septembre 1898 (Graudenz, Westpreußen) |
| Décès | 21 avril 1981 (Hof, Bayern) |
| Profession du père | Schuhmacher |
Der kommunistische Widerstandkämpfer Bruno Splitt (1898-1981) ist eines der NS-Opfer, die man sicher nicht in der Psychiatrischen Klinik der RUS erwarten würde. Er war seit Beginn der 1920er Jahre in der Arbeiterbewegung des Ruhrgebiets aktiv. Zur Zeit der Machtübernahme führte er seine Tätigkeiten in veränderter Form im Untergrund fort und wurde in Reorganisationsphase der KPD eine zentrale Figur des kommunistischen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus in Essen. Unablässig den Repressionen des NS-Regimes ausgesetzt, führte sein Weg über insgesamt fünf Konzentrationslager schließlich ins KZ Natzweiler-Struthof im Elsass. Von dort aus wurde er zur augenärztlichen Behandlung in der Psychiatrischen Klinik der RUS aufgenommen, was zunächst erstaunt, aber aus reinen Sicherheitsgründen geschah. Bruno Splitt war einer von insgesamt 18 bis jetzt identifizierten Natzweiler-Häftlingen, die in der RUS behandelt wurden. Seine Biographie steht exemplarisch für diese ungewöhnliche Verbindung zwischen dem Konzentrationslager und der „Reichsuniversität“.
Biographie
Essen im Sommer 1933. „Weil ich aber bald merkte, daß ich festgenommen werden sollte, wurde ich flüchtig. [...] Ich hielt mich innerhalb des Stadtgebiets verborgen. Ich habe mal 8 Tage hier und mal 8 Tage dort gewohnt, es kann auch sein, daß ich manchmal an einer Stelle länger gewohnt habe.“ So schilderte der kommunistische Widerstandkämpfer Bruno Splitt seine Zeit im Untergrund. Viel mehr ist über diesen Lebensabschnitt Bruno Splitts aus den Quellen nicht zu erfahren – außer, dass er quasi seit dem Frühjahr 1933 wie viele seiner Genoss*innen ständigen Repressionen ausgesetzt war. Im Juni 1933 war ein Haftbefehl gegen ihn erlassen worden, sodass er jederzeit damit rechnen musste, festgesetzt zu werden. Ein Blick auf die Geschehnisse in Essen, eine Hochburg der Arbeiterbewegung im Ruhrgebiet, lässt erahnen, was das für ihn persönlich bedeutet haben muss. Der nationalsozialistische Terror nach der Machtergreifung manifestierte sich täglich aufs Neue. Vor Übergriffen, Gefangennahmen und Folter konnte keiner der organisierten Arbeiter*innen mehr sicher sein. Die Gefängnisse waren hoffnungslos überfüllt und viele verschwanden in den neu entstehenden KZs. In Bochum wurden mehrere KPD-Funktionäre in einer SA-Kaserne physisch misshandelt, schwerverletzt durch die Straßen geschleppt und schließlich dort in der Öffentlichkeit liegen gelassen. Auch vor Mord schreckte die SA nicht zurück: Nach der Zerschlagung der Gewerkschaften am 2. Mai 1933 fanden Spaziergänger*innen die Leichen von vier Funktionären des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbunds im Wasser. Damit seien nur einige wenige Beispiele genannt, die die Realität des Terrors widerspiegeln. Der gewaltvolle Umgang der Gestapo mit verhafteten Genoss*innen dürfte Bruno Splitt sicher nicht verborgen geblieben sein und muss mit den fortwährenden Repressionen eine psychisch höchst belastende Atmosphäre der Angst geschaffen haben. Diese Situation spitzte sich im Oktober 1933 noch erheblich zu, als von der Polizei in Essen im großen Umfang Fahrradkontrollen durchgeführt wurden, bei denen sich die betreffende Person ausweisen musste. Um Bruno Splitt eine falsche Identität zu verleihen und damit vor der drohenden Verhaftung zu bewahren, übergab ihm seine Frau Hedwig den Militärpass seines Bekannten mit dem Namen Fritz Kleta (geb. 1.02.1895 in Berlin-Steglitz, - ?). Dies konnte Bruno Splitt jedoch nicht schützen, er wurde in Essen-Bottrop im Dezember 1933 festgenommen. Die Polizei fand den Ausweis bei ihm, den er wohl nicht verwendet hatte. Es ist denkbar, dass die Polizei genau wusste, wie der Gesuchte aussah – die entsprechende Akte enthält ein ziviles Passfoto von Bruno Splitt.
Arbeiterbewegung und kommunistischer Widerstand in Essen
Bruno Splitt wurde am 4. September 1898 in Graudenz (damals Westpreussen, heute Polen) als Sohn des Schuhmachers Ernst und dessen Ehefrau Pauline Splitt geboren. Über seine Kindheit ist fast nichts bekannt. Von 1907 bis 1912 besuchte er die Grundschule, vermutlich in seinem Geburtsort. Danach zog er nach Essen. Dort angekommen, war Bruno Splitt zuerst als Laufbursche und dann als Lagerist bei der Firma Grubenbecker beschäftigt. Von 1916 bis 1917 arbeitete er als Presser bei der Firma Thyssen. Vom September 1917 bis Juli 1919 war er zum Heeresdienst eingezogen, vom Januar 1918 bis 9. April 1918 befand er sich an der Westfront. Bei den langen Märschen traten gesundheitliche Probleme an seinen Füßen auf und er wurde zurück nach Deutschland zum „Landsturm“ in Schlettstadt im Elsass (heute frz. Sélestat) versetzt. Nach Ende des Ersten Weltkrieges und der Demobilisierung arbeitete er zunächst in einer Kohlefabrik in der Nähe der Essener Zeche Wolfsbank. Er war zusammen mit Ernst und Emil Splitt in der Germaniastraße 71 in Essen gemeldet. Bei erstgenanntem handelt es sich definitiv um seinen Bruder, bei zweitgenanntem ist dies ebenso denkbar. In dieser Zeit engagierte Bruno Splitt sich erstmals politisch. Er organisierte sich 1919 gewerkschaftlich im „Bergarbeiterverbund Deutschland“ und trat im Oktober 1920 der USPD bei, um nach deren zunehmenden Verfall und Machtverlust der neu gegründeten KPD anzugehören. Bruno Splitt war danach mehrfach bei der Firma Krupp in Essen beschäftigt (Abb. 2).
Repères
Localisations
Nationalités
- Allemand (1898 - 1981)
- Allemand (1898 - 1981)
Confessions
Publications
Références