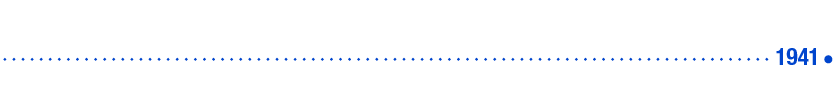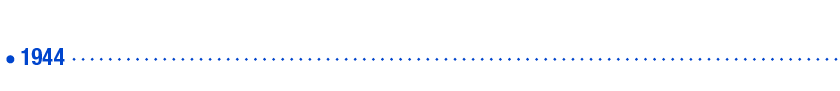Différences entre les versions de « Bruno Splitt »
m (Wurde mit Schaltfläche „Zwischenspeichern“ im Formular gespeichert) |
m (Wurde mit Schaltfläche „Zwischenspeichern“ im Formular gespeichert) |
||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
Arbeiterbewegung und kommunistischer Widerstand in Essen | Arbeiterbewegung und kommunistischer Widerstand in Essen | ||
Bruno Splitt wurde am 4. September 1898 in Graudenz (damals Westpreussen, heute Polen) als Sohn des Schuhmachers Ernst und dessen Ehefrau Pauline Splitt geboren. Über seine Kindheit ist fast nichts bekannt. Von 1907 bis 1912 besuchte er die Grundschule, vermutlich in seinem Geburtsort. Danach zog er nach Essen. Dort angekommen, war Bruno Splitt zuerst als Laufbursche und dann als Lagerist bei der Firma Grubenbecker beschäftigt. Von 1916 bis 1917 arbeitete er als Presser bei der Firma Thyssen. Vom September 1917 bis Juli 1919 war er zum Heeresdienst eingezogen, vom Januar 1918 bis 9. April 1918 befand er sich an der Westfront. Bei den langen Märschen traten gesundheitliche Probleme an seinen Füßen auf und er wurde zurück nach Deutschland zum „Landsturm“ in Schlettstadt im Elsass (heute frz. Sélestat) versetzt. Nach Ende des Ersten Weltkrieges und der Demobilisierung arbeitete er zunächst in einer Kohlefabrik in der Nähe der Essener Zeche Wolfsbank. Er war zusammen mit Ernst und Emil Splitt in der Germaniastraße 71 in Essen gemeldet. Bei erstgenanntem handelt es sich definitiv um seinen Bruder, bei zweitgenanntem ist dies ebenso denkbar. In dieser Zeit engagierte Bruno Splitt sich erstmals politisch. Er organisierte sich 1919 gewerkschaftlich im „Bergarbeiterverbund Deutschland“ und trat im Oktober 1920 der USPD bei, um nach deren zunehmenden Verfall und Machtverlust der neu gegründeten KPD anzugehören. Bruno Splitt war danach mehrfach bei der Firma Krupp in Essen beschäftigt (Abb. 2). | Bruno Splitt wurde am 4. September 1898 in Graudenz (damals Westpreussen, heute Polen) als Sohn des Schuhmachers Ernst und dessen Ehefrau Pauline Splitt geboren. Über seine Kindheit ist fast nichts bekannt. Von 1907 bis 1912 besuchte er die Grundschule, vermutlich in seinem Geburtsort. Danach zog er nach Essen. Dort angekommen, war Bruno Splitt zuerst als Laufbursche und dann als Lagerist bei der Firma Grubenbecker beschäftigt. Von 1916 bis 1917 arbeitete er als Presser bei der Firma Thyssen. Vom September 1917 bis Juli 1919 war er zum Heeresdienst eingezogen, vom Januar 1918 bis 9. April 1918 befand er sich an der Westfront. Bei den langen Märschen traten gesundheitliche Probleme an seinen Füßen auf und er wurde zurück nach Deutschland zum „Landsturm“ in Schlettstadt im Elsass (heute frz. Sélestat) versetzt. Nach Ende des Ersten Weltkrieges und der Demobilisierung arbeitete er zunächst in einer Kohlefabrik in der Nähe der Essener Zeche Wolfsbank. Er war zusammen mit Ernst und Emil Splitt in der Germaniastraße 71 in Essen gemeldet. Bei erstgenanntem handelt es sich definitiv um seinen Bruder, bei zweitgenanntem ist dies ebenso denkbar. In dieser Zeit engagierte Bruno Splitt sich erstmals politisch. Er organisierte sich 1919 gewerkschaftlich im „Bergarbeiterverbund Deutschland“ und trat im Oktober 1920 der USPD bei, um nach deren zunehmenden Verfall und Machtverlust der neu gegründeten KPD anzugehören. Bruno Splitt war danach mehrfach bei der Firma Krupp in Essen beschäftigt (Abb. 2). | ||
Zunächst arbeitete er ab dem 16. Oktober 1920 dort als Hilfsarbeiter, bis er aufgrund von „Arbeitsmangel“ am 23. November 1923 vermutlich im Zuge der Hyperinflation und der gleichzeitigen französisch-belgischen Ruhrbesetzung entlassen wurde. Ähnliches wiederholte sich nachdem er am 25. Juli 1927 eingestellt und am 18. September 1929 vermutlich aufgrund der sich zuspitzenden Weltwirtschaftskrise entlassen wurde. Zwischenzeitlich fand er als Bergmann auf der Zeche Carolus Magnus, einem Steinkohlebergwerk in Essen-Bergeborbeck wieder Arbeit. Diese Stelle verlor er aufgrund eines Arbeitsunfalls, bei dem er sich den linken Daumen brach. Es folgten einige Jahre der Arbeitslosigkeit währenddessen er von „Erwerbslosenunterstützung“ lebte. In dieser Zeit wendete er sich vermehrt der Politik zu. Bereits seit 1927 war er als Unterkassierer und Org.-Leiter der KPD für den Essener Stadtteil Borbeck tätig. Diese Funktion übte er bis zum 1. März 1933 aus. Er geriet zunehmend durch seine politischen Aktivitäten ins Visier der Polizei. Am 29. Oktober 1929 nahm Bruno Splitt an einer Demonstration gegen das Verbot des paramilitärischen Roten Frontkämpferbundes (RFB) teil. Er wurde verdächtigt, einer der ebenfalls verbotenen Nachfolgeorganisationen anzugehören, weswegen er verhaftet wurde. Das zuständige Schöffengericht sprach ihn jedoch am 21. August 1930 von allen Vorwürfen frei. Am 27. Mai 1930 heiratete Bruno Splitt die Hausangestellte Hedwig Frieda Johanna Rittelmeyer (geboren am 26. Mai 1909 in Essen-Borbeck). Zum Zeitpunkt seiner Hochzeit waren seine Eltern, die in Graudenz verblieben waren, bereits verstorben. | |||
Bruno Splitts Trauzeuge war der mit ihm Verwandte Bergmann Emil Splitt. Am 21. März 1931 war Splitt in eine „politische Schlägerei“ verwickelt, die eine Verurteilung zu einer Geldstrafe von 20 RM und 4 Tagen Gefängnis wegen gefährlicher Körperverletzung am 24. Juli 1931 verurteilt. Im gleichen Jahr wurde gegen ihn wegen des Tragens einer Armbinde mit der Aufschrift „Roter Helfer“ ein Erfahren eingeleitet, dass aber im September 1931 eingestellt wurde. Immer wieder leitete Splitt im Essener Stadtteil Borbeck Versammlungen und Kundgebungen der KPD, besonders häufig im Lokal „Brück“. | |||
Sein politisches Engagement beschränkte sich nicht auf die Ebene der Parteiarbeit und praktische Aufgabenbereiche. Zu Beginn der 1930er Jahre hat Splitt an einen Kurs an der internen Reichsparteischule Rosa-Luxemburg in Fichtenau (Baden-Württemberg) teilgenommen. Diese diente zur Vermittlung und Diskussion der marxistisch-leninistischen Philosophie und schloss auch die Lektüre des Kapitals und anderer Schriften von Marx sowie Lenin und anderen mit ein. Außerdem wurden die Geschichte der Arbeiterbewegung und Strategie und Praxis der politischen Arbeit thematisiert und ein Erfahrungsaustausch unter den Kommunist*innen angeregt. Die Seminarist*innen wurden von Parteikoryphäen wie Hermann Duncker, Karl- August Wittvogel und Ernst Scheller unterrichtet. Regelmäßig hielten dort auch Wilhelm Pieck und Ernst Thälmann Vorträge. Wen Bruno Splitt dort persönlich getroffen hat, muss offenbleiben. Die Teilnehmer*innen hatten vorab eine Lektüre zur Vorbereitung zu lesen und sich durch eine eingereichte Hausarbeit für die Teilnahme zu qualifizieren. Die Atmosphäre des Ortes wurde von Zeitzeug*innen als von „Lernbegeisterung“ und der „Macht des Wissens“ geprägter Ort beschrieben. Bruno Splitts politische Karriere in der Weimarer Republik fand ihren Höhepunkt mit seiner Wahl 1932 zum Stadtverordneten in Essen. Es gehörte nun zu seinen Aufgaben, Versammlungen der Partei zu leiten, so organisierte in führender Position im Dezember 1932 den Unterbezirksparteitag der KPD in Essen. | |||
Wie eingangs bereits deutlich wurde, erfuhr die politische Arbeit Bruno Splitts mit der Machtergreifung eine tiefe Zäsur. Er arbeitete mittlerweile wieder als Bergmann und wohnte in Essen-Fintrop im Graffweg 19. Die Nachricht über die Regierungsbildung am 30. Januar 1933 veranlasste die Menschen in vielen Teilen des Ruhrgebiets dazu, auf der Straße ihrer Empörung Ausdruck zu verleihen. Auch in Essen-Borbeck fanden Demonstrationen statt, bei denen gut denkbar ist, dass Bruno Splitt daran teilnahm. Die NSDAP erreichte bei den Reichstagswahlen im März 1933 auch in Essen mit 30,6 Prozent der abgegebenen Stimme auf dem demokratisch-legalen Weg keine Mehrheit. Die Bezirksleitung Ruhrgebiet der KPD erklärte daraufhin in einem Rundschreiben: „Die Entwicklung des Faschismus in der Vergangenheit trug mehr einen quantitativen Charakter. Die Kette der terroristischen Bluttaten und Mordakte... [...] Nunmehr aber mit der legalen Einbeziehung der Nazis und Stahlhelmer in den Staatsapparat beginnt der Umschlag in die qualitative Entwicklung des Faschismus in der Linie des legalen, wohldurchdachten, zentralen und organisierten Einsatzes der faschistischen Terrorformation.“ In den Gemeindewahlen am 12. März 1933 entfielen auf die NSDAP genau 31 Mandate. Auch hier bedeute dies keine Mehrheit, die sich die Nazis nun aber auf gewaltsamen Weg aneignete, indem sie die 12 Mandate der KPD ersatzlos streichen ließ. In den Monaten nach der Machtergreifung war Splitt weiter in der Verwaltung von Finanzen und Kassieren sowie auch beim „Vertrieb von Flugblättern“ involviert. Wie Bruno Splitt diese Zeit persönlich erlebt hat, bleibt im Dunkeln. Aber die Schilderungen über die Geschehnisse in den Arbeitervierteln Essens lassen erahnen, in welch bedrohlicher Situation seine Genoss*innen und er sich befunden haben müssen. Die SS, SA und Polizei umzingelte mehrfach die Häuserblocks der Arbeiter*innen, die als „Zentren des politischen Widerstandes“ gegen die Nationalsozialisten galten und durchsuchten sie Haus für Haus, wobei prominente Personen verhaftet wurden. Man versuchte der organisierten Arbeiterschaft zuzusetzen, indem „politische Bücher und Zeitungen“ bis hin zu „Sportgeräte und Musikinstrumente der Arbeiterkulturorganisationen“ entwendet wurden. Derartige Razzien fanden in verschiedenen Stadtteilen Essens vom Frühjahr bis September 1933 statt. Die Arbeiterbewegung beantwortete dies mit mannigfaltigen Widerstandsaktionen. Eine der kreativsten Protestakte bestand darin, über Nacht einen weithin sichtbaren „Rot Front“-Schriftzug an einem zentral gelegenen Bürohaus anzubringen. Ob und wie sich Bruno Splitt an diesen oder ähnlichen Aktionen beteiligte, ist unklar. Fest steht jedoch, dass Bruno Splitt nicht davon abließ, die Organisationsstruktur der KPD zu reorganisieren und deren Handlungsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Dies blieb nicht ohne Konsequenzen. Das Amtsgericht in Essen erließ am 11. Juli 1933 Haftbefehl gegen Bruno Splitt. Er wurde beschuldigt im Mai des gleichen Jahres „gemeinschaftlich mit Anderen handelnd, es unternommen zu haben, die Verfassung des Deutschen Reiches gewaltsam zu ändern, durch dieselbe Handlung anders, ein hochverräterisches Unternehmen vorbereitende Handlungen unternommen zu haben, - Verbrechen gegen §§ 81, Z. 2, 86, 47, 73 St.G.B. [...] Fluchtverdacht ist gesetzlich begründet, da ein Verbrechen Gegenstand der Untersuchung bildet. Auch besteht mit Rücksicht auf die Teilnahme mehrerer Verdunklungsgefahr.“ Schließlich wurde Bruno Splitt am 11. August 1933 mit vier anderen Kommunisten angeklagt, die im oben zitierten Haftbefehl genannten Verbrechen im April des gleichen Jahres begangen zu haben. Zum Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung saßen Bruno Splitts mitangeklagte Genossen alle in Untersuchungshaft, er selbst konnte sich noch vor dem Zugriff der Polizei versteckt halten. Aus der Perspektive der Essener Polizei war Bruno Splitt „kommunistischer Funktionär“ und „fanatischer Anhänger der kommunistischen Ideen“. Bruno Splitt initiierte laut der Urteilsbegründung zufolge im April 1933 die Verbreitung von verschiedenen Flugblätter und Zeitschriften der KPD. Er soll 40 Exemplare an seinen Genossen Johann Klaus zur weiteren Verteilung übergeben haben. Die Drucksachen informierten über die Repressionsmaßnahmen des NS-Regimes, forderten eine Freilassung Ernst Thälmanns und aller anderer Inhaftierten. Ebenso waren der Aufruf zur Organisation der Arbeiterbewegung und Widerstand Thema. In der Anklageschrift wurde die Verteilung der Schriften als „Vorbereitung zum Hochverrat“ gewertet, da die KPD die Errichtung einer „Rätediktatur des Proletariats nach sowjet-russischem Vorbild“ anstrebte. Im Sinne der Anklage wurden alle seine Genossen als schuldig befunden und erhielten Zuchthausstrafen von einem Jahr und neun Monaten. Bruno Splitt wird in dem Urteil nicht erwähnt, da er sich wie eingangs beschrieben zunächst versteckt halten konnte. Nach seiner Verhaftung wurde er ins Essener Untersuchungsgefängnis verbracht. Seine Frau Hedwig besuchte ihn dort einige Tage vor Weihnachten 1933. Wann und ob er seine Frau danach nochmals wiedergesehen hat, ist ungewiss. | |||
Die Widerstandgruppe um Bruno Splitt hatte sich im Jahr 1933 offensichtlich nicht von den massiven Repressionen einschüchtern lassen und ihre Arbeit fortgesetzt. Nach seiner Verhaftung wurde er im Jahr 1934 nun dafür erneut juristisch verfolgt und stand zusammen mit 83 anderen Kommunist*innen wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ vor Gericht. Der Zusammenschluss hatte die Vervielfältigung von Schriften und deren Verteilung wiederaufgenommen. Im Zuge der Ermittlungen wurden eine Schreibmaschine, ein Vervielfältigungsapparat und diverse Druckschriften und Flugblätter von der Polizei beschlagnahmt. Schenkt man den Ergebnissen der polizeilichen Untersuchungen Glauben, dann sah Bruno Splitts Tätigkeit im kommunistischen Widerstand nach der Machtübernahme folgendermaßen aus. Splitt stand neben zwei anderen Angeklagten an der „Spitze der Organisation“ und war ununterbrochen in Essen politisch aktiv. Im Wortlaut der Anklageschrift bezeichneten die anderen aus der Gruppe Bruno Splitt als den „Macher“, der die Initiative ergriff, die unterschiedlichen Aufgabebereiche miteinander vernetzte und auch andere zur Mitarbeit bewegen konnte. Die Region des Ruhrgebiets wurde bei dem Versuch ein Widerstandsnetz aufzubauen in sechs sogenannte „Instruktionsgebiete“ aufgeteilt. Die Stadt Essen entsprach dem „Bezirk II“ und war wiederum in vier „Unterbezirke“ aufgegliedert: Altessen, West, Mitte und Kray-Steele. Laut der Urteilsbegründung hatte bei dieser Reorganisationsphase Bruno Splitt „eine besondere Rolle“ gespielt. Er habe nach der Machtübernahme seine bereits seit Oktober 1932 wahrgenommene Tätigkeit als „Orgleiter des Unterbezirks Groß-Essen“ im Untergrund wiederaufzunehmen und die „Organisation der KPD [...] wiederherzustellen. Er sei in den verschiedenen Stadtteilen Essens „eifrig tätig“ gewesen. Seine Aufgabe sein es gewesen Genossen zur „illegalen Tätigkeit und zur Übernahme von Funktionärsposten“ wie beispielsweise als „Kassierer“ einzuteilen und zu motivieren. Damit hatte er der Urteilsbegründung zufolge bereits direkt nach der Machtergreifung begonnen. Er war maßgeblich an der Organisation der Verbreitung von „Informations- und Propagandamaterial“ beteiligt. Es folgten regelmäßige Treffen mit diversen Genoss*innen. Es sei ihm dadurch gelungen „in fast allen Stadtteilen Funktionäre für die KPD“ zu gewinnen und die „alte Organisation zu beleben“. Er soll beispielsweise die Einrichtung einer „Postanlaufstelle“ im Mai oder Juni 1933 initiert haben, die zum Dreh- und Angelpunkt der Vervielfältigung und Verteilung der Flugschriften werden sollte. Die Gruppe schaffte es, mehrere tausend Flugblätter herzustellen und zu verbreiten. Weiterhin wurde Geld zur Unterstützung u. a. von inhaftierten Mitgliedern der KPD und deren Familien gesammelt. Auch die Organisation der illegalen Tätigkeit war ohne finanzielle Mittel nicht möglich. Die Bezirksleitung Ruhrgebiet rief dazu auf, regelmäßig die Beiträge zu entrichten, denn „jeder Pfennig ist heute Munition.“ Die Einnahmen beliefen sich beispielsweise im Herbst 1933 monatlich auf rund 1000 RM, das zeitgenössisch als „Opfermut“ der Widerstandkämpfer*innen gedeutet wurde – waren doch viele von ihnen arbeitslos. Auch übernahm Splitt erneut die Funktion eines Funktionärs im Unterbezirk von Essen, die er angeblich wegen eines „Nervenzusammenbruchs“ im Juli 1933 zwischenzeitlich aufgegeben haben soll. Es liegt nahe, dass er diesen als Reaktion auf den Haftbefehl erlitten hat. In einer Zusammenkunft mit anderen Angeklagten am 13. November 1933 wurde geplant, dass er zukünftig als „Polleiter“ das „Instruktionsgebiet Gelsenkirchen“ ebenfalls übernehmen sollte. Durch seine Festnahme kam es anscheinend aber nicht mehr dazu. Am Ende des Verfahrens wurden in der Urteilsverkündung am 19. Oktober 1934 unterschiedliche Strafen verhängt, Bruno Splitt wurde zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt. Dabei wurden ihm acht Monate und zwei Wochen von der Untersuchungshaft angerechnet. | |||
Die beschriebe Tätigkeit ist paradigmatisch für die Widerstandsaktivitäten nach dem Übergang der KPD in die Illegalität zum Zeitpunkt des Reichtagbrandes. Da viele der Führungskader verhaftet waren, warten die örtlichen Gruppen nicht lange auf Weisungen und versuchten auf Eigeninitiative hin den „Zusammenhalt [zu] wahren, Gelder [zu] sammeln“ sowie „Informationsmaterialien“ herzustellen und deren Verteilung zu organisieren. Bereits im Vorfeld waren Material wie Druckmaschinen, Matrizen, Schreibmaschinen und Papier an geschützten Orten deponiert worden. Das publizistische Organ der KPD im Wirkungskreise Bruno Splitts war das „Ruhr-Echo“, deren Reproduktion und Verteilung seinen Genoss*innen und ihm in der Anklageschrift zur Last gelegt wurde. Auch wenn dieser Widerstand auf einer weit verbreiteten, fatalen Fehleinschätzung der KPD beruhte, dass das NS-Regime durch ein nur ausreichendes Aufgebot an Gegenwind in absehbarer Zeit geschlagen werden könne, schmälert dies jedoch nicht dem Mut, den Splitt und seine Mitkämpfer*innen aufgebracht haben. | |||
Esterwegen – Sachsenhausen – Natzweiler – Dachau – Neuengamme: Eine Odyssee durch die Konzentrationslager | |||
Am 25. Dezember 1935 hatte Bruno Splitt seine Zuchthausstrafe in der Strafanstalt Münster in Westfalen abgesessen. Die Strafanstalt teilte mit, dass er sich „zwar gut geführt hätte“, aber eine „innere Umstellung bei ihm nicht zu erkennen gewesen“ sei. Nach der Einschätzung der zuständigen Gestapo Düsseldorf, Außendienststelle Essen, handelte es sich bei Bruno Splitt um einen „ganz gefährlichen Kommunisten“. Der zuständige Strafanstaltsdirektor in München bezeichnete Splitt darüber hinaus als „Großmaul“. Daher wurde er über das Gefängnis in Essen in Schutzhaft ins KZ Esterwegen eingewiesen. Die von der Gestapo Essen und dem KZ verfassten Schreiben und Beurteilungen anlässlich anstehender „Haftprüfungstermine“ waren Ausdruck der Willkürherrschaft und lesen sich wie bloße Makulatur. Fast gänzlich unabhängig von Bruno Splitt „Führung“ im Lager und egal wie oft er die Aussage tätigte, er wolle sich politisch nicht mehr betätigen – einem einstweilen „rührigen Kommunisten“ glaubte man nicht und die Schutzhaft wurde mehrfach verlängert. Die Rekonstruktion der folgenden Odyssee durch die Konzentrationslager bleibt leider auf die rudimentären Dokumente aus der Täterperspektive beschränkt. Auch in den zahlreich vorliegenden Gesprächen mit Überlebenden der unterschiedlichen KZs blieb die Person Bruno Splitt unerwähnt. Damit bleiben die Fragestellungen, die sich auf das persönliche „Erleben“ und die „Wahrnehmung“ Bruno Splitts innerhalb der „(Zwangs-)Gesellschaft Konzentrationslager“ beziehen, unbeantwortet. Eine Annäherung an seinen Alltag wurde durch den Rückgriff auf allgemeinere Literatur versucht. | |||
Als das Schutzhaftlager Esterwegen im Sommer 1936 aufgelöst wurde, wurden die Häftlinge in das neu entstehende KZ Sachenhausen bei Oranienburg im Norden von Berlin verlegt. Bruno Splitt wurde in Sachsenhausen unter der Häftlingsnummer 000373 als Schutzhäftling registriert und zunächst im Häftlingsblock 5 und später in den Blöcken 12, 18 und 23 untergebracht. In Sachenhausen begann der Aufbau des KZ mit der Rodung eines 80 Hektar großen Waldstücks. Im folgenden Jahr wurden rund 100 Gebäude von den Häftlingen errichtet, darunter Häftlingsbaracken, SS-Kasernen, Wirtschaftsgebäuden und SS-Siedlungshäuser. Bruno Splitt hingegen war im Jahr 1936 als „Stubenältester, Blockeinkäufer und später Lagereinkäufer“ tätig und hatte damit in der Lagerhierarche als Funktionshäftling eine recht privilegierte Position. Im Frühjahr 1938 wurden in Sachsenhausen die unterschiedlichen Häftlingswinkel eingeführt. Bruno Splitt wird als „Schutzhäftling“ sehr wahrscheinlich einen roten Winkel getragen haben. | |||
Während Bruno Splitt im KZ Sachenhausen interniert war, floh seine Frau Hedwig Splitt mit einem Touristenvisum über Amsterdam nach Brüssel, wo sie irgendwann im Januar oder Februar 1937 ankam. Dort wurde sie zunächst als politischer Flüchtling registriert, wobei dieser Status in den kommenden Jahren immer wieder von den Behörden in Frage gestellt wurde. Zunächst erhielt sie nur eine befristete Aufenthaltsgenehmigung bis zum Ende März 1937. Gegenüber den Behörden gab Hedwig Splitt an, dass sie „wegen politischer Arbeit“ geflüchtet sei, sie gehöre seit 1934 der „Trotzky [?]-Bewegung“ an. Sie habe Belgien gewählt, „weil meine Freunde hier sind“. In Brüssel wohnte sie bei der Belgierin Nora Sachse, die sie in ihren Angelegenheiten unterstützte, vermutlich einer der genannten Freunde. In einem anderen Fragebogen wiederum beantwortete Hedwig Splitt die Frage nach dem Grund für ihre Flucht folgendermaßen: „wegen illegaler Tätigkeit“ und „Beihilfe zur Flucht“. Um welche Flucht es sich handelte, bleibt unklar. Weiterhin beabsichtigte in Belgien zu „arbeiten, wenn es geht“. Die letzten Unterlagen, die sich erneut um ihren Aufenthaltsstatus drehen, datieren auf das Jahr 1941. Danach verliert sich ihre Spur. | |||
Illustration rosa Schutzhaftbefehl Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland, RW 0058 (Geheime Staatspolizei – Staatspolizeileitstelle Düsseldorf), Nr. 927 ( JPEG 0063) | |||
Nach insgesamt dreijähriger Haft wurde Bruno Splitt kurz vor Weihnachten, am 21. oder 23. Dezember 1938 aus Sachenhausen entlassen, was in dieser Zeit nicht unüblich war. Nach seiner Freilassung arbeitete er als Bergmann auf der Zeche Carolus Magnus, einem Steinkohlebergwerk in Essen-Bergeborbeck. Seine Zeit in Freiheit war nicht von langer Dauer. Im Zuge der „Aktion 1.9.1939“ wurde er auf seiner Arbeitsstelle erneut festgenommen. Bruno Splitt gab in der Nachkriegszeit an, vom 8. September 1939 an erneut in Sachsenhausen gewesen zu sein. Damit gehörte er zu den rund 800 deutschen Männern, die von der Gestapo „nach lange vorbereiteten Listen“, die sogenannte Aktion „A-Kartei“ als politische Gegner nach Kriegsbeginn inhaftiert wurden. Bei dieser zweiten Inhaftierung erhielt er die Nummer 12 146. Im Jahr 1939 war er zunächst im „Lagerbau – SS-Siedlung – „tätig und anschließend seit Februar 1940 als „Einkäufer für den Krankenbau“. Er ist während seiner Haftzeit mehrmals erkrankt. Vom 21. Oktober 1940 bis 4. November 1940 wurde er wegen einer Phlegmone und erneut vom 10. Februar 1941 bis 18. März 1941 wegen einer Phlegmone am Knie behandelt. Dies belegt auch eine Liste zum Zugang im Krankenbau am 10. Februar 1941. [Behandlung in den Häftlingskarten Arolsen unleserlich] | |||
Am 2. Oktober 1940 wurde er einer Strafkompanie zugewiesen, da ihn ein Häftlingssanitäter beim Blockführer dieser Strafkompanie denunzierte und angab, Splitt hätte „illegale Geschäfte mit Kantinenware“ betrieben. Damit verlor Splitt zunächst seine privilegierte Position als Funktionshäftling. Dies könnte im Zusammenhang mit Streitigkeiten der Häftlingsgruppen „Politische“ und „Kriminelle“ stehen, die um diese Posten konkurrierten. Die Häftlinge dieser Strafkompanie wurden besonders harten Arbeitskommandos zugeteilt. In Zusammenhang mit den „ständigen Misshandlungen“ bedeutete dies für viele den Tod. Zusätzlich erhielt Splitt „50 Stockschläge, 2 Stunden Pfahlhängen und 14 Tage Zellenbau“ seitens der Lagerleitung. Dies waren typische „Lagerstrafen“, die viele Häftlinge nicht überlebten. Die physiologischerweise gut durchbluteten Nieren wurden bei diesem Gewaltakt häufig derart in Mitleidenschaft gezogen, dass die Häftlinge schlichtweg verbluteten. Der niederländische Häftling Ab Nicolaas berichtete, dass nach der Prügelstrafe der „kaputtgeschlagene Hintern“ mit Hilfe von eigens zu diesem Zweck aufbewahrten „Margarineverpackungen“ „ganz vorsichtig“ behandelt worden wäre. Es ist denkbar, dass die Strafe im Zellenbau vollstreckt wurde oder später auch lageröffentlich auf dem Appellplatz. Diesen Zellenbau ließ die SS Anfang 1937 errichten. Es handelte sich um ein T-förmiges Gefängnisgebäude mit 80 Zellen. Die SS vollstreckte in dem Gebäude Strafen und führte Verhöre durch. Zum dem Zeitpunkt als Bruno Splitt misshandelt wurde, geschah dies noch durch die SS selbst. Ab August 1942 wurden Mithäftlinge gezwungen die Prügelstrafe zu vollziehen. Nach Verbüßung dieser drakonischen Strafe wurde Bruno Splitt im November 1940 für fünf Wochen dem berüchtigten „Schuhläuferkommando“ zugeteilt, dem er etwa fünf Wochen angehörte. Seit dem Sommer 1940 wurden die Häftlinge dieses Strafkommandos gezwungen im Auftrag der Schuhindustrie die Sohle der Schuhe zu testen. Dies fand auf einer eigens dafür eingerichteten „Schuhprüfstrecke“ statt, die um den Appellplatz des Lagers herum führte. Bei jeder Witterung mussten die Häftlinge täglich bis zu 40 Kilometer in strammen Schritt im Kreis gehen. Wer dem nicht nachkommen konnte, wurde von der SS misshandelt. Bruno Splitt war einer der wenigen, der diese Torturen über die fünf veranschlagten Wochen überhaupt überlebte. | |||
Die restliche Zeit in der Strafkompanie bis zu seiner Verlegung nach Natzweiler am 20. Mai 1941 gehörte Bruno Splitt anschließend dem sogenannten Lorenkommmando an. Aus einem ärztlichen Gutachten in der Nachkriegszeit ist bekannt, dass Splitt im Winter 1939/40 erstmals an „Schwächezustände[n]“ und Herzanfälle[n]“ litt. Dies ist nicht verwunderlich, da dieser Winter als der erste „Hungerwinter“ in Sachsenhausen bezeichnet wird. Ende 1939 hatte sich die Lage angesichts der Masseneinlieferungen seit Kriegsbeginn drastisch verschlechtert. Wegen der wachsenden Häftlingszahlen wurden die Essensrationen mehrfach verkürzt und der alltägliche Terror der SS nahm zu. So mussten viele Arbeiten beispielsweise im Laufschritt erledigt werden. | |||
KZ Natzweiler und die Behandlung in der RUS | |||
Am 22. Mai 1941 endete Bruno Splitts Internierung in Sachsenhausen, wo insgesamt rund 200.000 Häftlinge inhaftiert waren. Davon überlebte nur ungefähr die Hälfte den täglichen Terror. Bruno Splitt war einer von ihnen. Dies bedeutete jedoch keineswegs seine Entlassung. Inzwischen war seit Anfang Mai der Bau des KZ Natzweiler-Struthof im Gange, wohin Splitt am 23. Mai 1941 verbracht und als Politischer Häftling mit der Nummer 230 registriert wurde. Er war damit Angehöriger des zweiten von insgesamt zwei Aufbau-Transporten, die Sachsenhausen verließen. Josef Kramer (10.11.1906 – 13.12.1945), der seit April 1941 Schutzhaftlagerführer in Natzweiler war, war zuvor nach Sachsenhausen gereist, um dort 300 langjährige Häftlinge zu diesem Zweck auszuwählen. Damit ist anzunehmen, dass Splitt als Funktionshäftling in Natzweiler vorgesehen und eingesetzt worden ist. Laut dem Effektenverzeichnis gab er bei der Einlieferung einen Hut, eine Jacke, eine Hose, vier Hemden, 1 Unterhose, drei Paar Strümpfe und ein Paar Schuhe ab. Seine „bevorzugte Post“ erhielt er von seinem Bruder Ernst Splitt aus Essen (damals wohnhaft Zweigstraße 11). Pro Kalendermonat erhielt und schrieb er mehrere Briefe. Über den persönlichen Alltag Splitts in Natzweiler ist fast nichts bekannt. Am 16. April 1943 erlitt Bruno Splitt in einen „Arbeitsunfall“, bei dem er sich eine „empfindliche Augenverletzung“ zuzog. Konkret handelte es sich um einen „Metallsplitter im rechten Auge“. Dieser Unfall hat soll sich in der „Häftlingsküche“ ereignet haben. Die Dokumente, die von der nachfolgenden Behandlung Splitts zeugen, sind alle von dem Lagerarzt und SS-Obersturmführer Franz von Bodman (auch Bodmann; 23.3.1908 – 25.5.1945) unterzeichnet. Bodmann ordnete an, dass Splitt am 19. April 1943 zur ambulanten Behandlung in der Augenklinik der „Reichsuniversität“ Straßburg eingewiesen wurde, um den Fremdkörper dort operativ entfernen zu lassen. Der Eingriff verlief offenbar nicht erfolgreich. Am 23. April wurde Brno Splitt zur „Enukleation des rechten Auges“ erneut in die RUS aufgenommen; diesmal war eine stationäre Behandlung notwendig. Um eine Flucht aus den zivilen Krankenanstalten zu vermeiden, wurde er in der Psychiatrischen Klinik (Station 58) untergebracht. „[W]eil in der Augenklinik keine Überwachung möglich war“, wie dort in Splitts Krankenakte notiert wurde. Dies war offenbar die gängige Verfahrensweise bei stationären Behandlungen von KZ-Häftlingen in der RUS. Dies legte eine handschriftliche Notiz des Lagerarztes Dr. Schiedlausky auf der Rückseite des Antrags zur Krankenhausbehandlung eines weiteren KZ-Häftlings aus Natzweiler nahe. Dort heißt es: | |||
„1) Sicherheit regeln: nach bisheriger Durchführung sollen die Häftlinge in einer Zelle der psych[iatrischen] Abt[ei]l[ung] untergebracht werden. Wer übernimmt die Sicherheit bei Vorführung zur Behandl[un]g oder kann diese in der Zelle zur Durchführung kommen wie bei dem Häftling Splitt?“ | |||
Gemeint ist die abschließbare Zelle in der psychiatrischen Klinik, die normalerweise zur Isolierung von psychomotorisch erregten und „gewalttätigen“ Patient*innen diente. Die ärztliche Dokumentation in der Psychiatrie beschränkte sich auf Folgendes „Da aus K.Z. Natzweiler, für die Dauer seiner Behandlung in der Augenklinik [...] hier in Verwahrung. Verhielt sich ruhig, unauffällig.“ Am 30. April 1943 wurde Splitt wieder zurück nach Natzweiler verbracht. Am 14. Mai 1943 wurde Splitt vom Lagerarzt ein drittes Mal in die RUS „zur Anpassung eines Kunstauges“ überwiesen. Die Überweisung erfolgt unter der Bereitstellung eines „Begleitposten“, der vermutlich für die Überwachung Splitts abgestellt wurde. Für die gesamte Behandlung und auch die Bezahlung des Glasauges kam die Lagerverwaltung auf. | |||
Angesichts dieser relativ privilegierten Behandlungsweise liegt der Schluss nahe, dass Splitt Funktionshäftling in Natzweiler war und die SS daher ein Interesse an der Erhaltung seiner Gesundheit und seines Augenlichts hatte. Dafür spricht auch der Umstand, dass er relativ gut mit Nahrungsmitteln versorgt war und sein Gewicht von 1941 bis 1943 relativ konstant um 70-73 Kilo blieb. Das beschriebene Vorgehen war kein Einzelfall. Während des Bestehens der RUS wurden dort insgesamt 18 Häftlinge aus dem KZ Natzweiler behandelt [Link zu anderen Bios]. Vergleichbare Fälle finden sich vereinzelt auch in anderen Konzentrationslagern. In Sachsenhausen erhielt der polnische Häftling Tadeusz Rogowski ebenfalls eine Augenprothese, die durch den dortigen Lagerführer besorgt worden war. Auch der Kommunist Ernst Brinkmann wurde nach einer Augenverletzung mit einem Kunstauge versorgt. Eine privilegierte medizinische Behandlung über die rudimentären Versorgungsstrukturen des KZ hinaus, findet sich generell auch in anderen Lagern. Fast 100 Häftlinge aus Sachsenhausen wurden im Staatskrankenhaus der Polizei in Berlin wegen anderer Leiden behandelt. Wer diese Häftlinge waren, ist bisher unbekannt. (Abschließende Einordnung der Verbindung zwischen RUS und Ntzweiler weiteren Forschungen vorbehalten, über 20 Häftlinge dort behandelt...) | |||
Bruno Splitt wurde am 21. September 1944 vor der Auflösung des KZ Natzweiler am 23 November 1944 ins KZ Dachau verlegt und von dort aus am 22. Oktober 1944 in das KZ Neuengamme. Neben Mauthausen in Österreich war Neuengamme das letzte KZ, das sich vor dem unmittelbaren Kriegsende noch im Machtbereich der Nazis befand. Wie Bruno Splitt die letzten Tage der Internierung erlebte und ob er auf einen Evakuierungsmarsch geschickt wurde, ist unbekannt. Am 2. Mai 1945 wurde Neuengamme von den Engländern befreit. Die gesundheitlichen Folgen der jahrelangen Haft begleiteten Bruno Splitt für sein restliches Leben. Bis Weihnachten des gleichen Jahres litt er immer wieder an Schwächezuständen. | |||
Nachkriegszeit | |||
Nach der jahrelangen Odyssee durch fünf verschiedene Konzentrationslager zog es Bruno Splitt zunächst zurück nach Essen, wo er ab dem 19. Dezember 1945 in der Zweigstraße 25 gemeldet war. Seine Ehefrau Hedwig hatte den Krieg ebenfalls überlebt. Die beiden fanden offenbar jedoch nicht mehr zusammen und die Ehe wurde am 8. Oktober 1947 geschieden. | |||
Bruno Splitt blieb nicht lange in Essen und zog am 08. Mai 1946 nach Goldkronach (Kreis Bayreuth), wo er ab dem 14. Mai 1946 offiziell gemeldet war. Vermutlich hatte sein Umzug berufliche Hintergründe. In Goldkronach angekommen, begann Bruno Splitt bei der Firma „Plantana Heilpflanzen-Anbau-und Verwertungs-GmbH“ als deren Geschäftsführer zu arbeiten. Seine Aufgabe war es u. a. die Abläufe zwischen den „vertraglichen Anbauern von Heilpflanzen“ und den „Sammlergruppen von Wildkräutern“ zu koordinieren. Gesundheitliche Gründe zwangen ihn, diese Stellung am 31. März 1948 aufzugeben. Währenddessen war Splitt bereits am 10. Oktober 1946 nach Hof umgezogen, eine kleine Stadt ebenfalls im Kreis Bayreuth. Vom 1. April 1948 bis zum 30. September 1949 arbeitete er in Hof bei der „Fränkischen Verbandmittelindustrie“ als Geschäftsführer. | |||
Entschädigungsverfahren | |||
Am 17. Oktober 1949 stellte Splitt beim „Landesamt für Wiedergutmachung“ einen Antrag und gab als „Körperschäden“ neben dem „Verlust des rechten Auges“ auch eine „Angina pectoris“ an. In der bürokratisch-verschleiernden Sprache seiner Akte werden die Gründe in der „unsachgemässe[n] Behandlung im KZ-Natzweiler“ bzw. in der die „KZ-Haft und die dort angewandten Methoden“ gesehen. Dabei waren Herz- und Kreislaufbeschwerden eine der häufigsten physischen Spätschäden infolge von KZ-Haft. Diesen waren dabei häufig „unabhängig von jeder klinischen, röntgenologischen oder elektrokardiographischen Symptomatik“. Bereits 1947 war ein einen Kuraufenthalt wegen dieser Beschwerden notwendig geworden. Nun beantragte Bruno Splitt ein „Heilverfahren“, eine seines Verdienstausfalls entsprechende Rente und eine „Kapitalentschädigung von 50 000 DM“ für sein verlorenes Augenlicht. Zur Überprüfung wurde ein ärztliches Gutachten im Stadtkrankenhaus in Hof eingeholt, das den kausalen Zusammenhang zwischen seinen Herzbeschwerden und der KZ-Haft infrage stellte. Auch ein weiteres amtsärztliches Gutachten von 1954 kam zu einem ähnlichen Ergebnis und konnte seine Klagen auf keinen „objektiven Befund“ zurückführen. Unabhängig davon wurde seine Erwerbsfähigkeit auf 60 Prozent geschätzt. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete Bruno Splitt stundenweise bei der Firma Schmitt & Co, die „Süsswaren“ vertrieb. Dennoch kam das Gesundheitsamt Hof zu dem Schluss, wenngleich „kein Anhalt für einen Herzmuskelschaden“ auszumachen sei, dass man „zu seinen Gunsten annehmen muss, dass durch die langjährige KZ-Haft mit ihrem Übermass an Anstrengungen und Strapazen eine vorübergehende [Hervorhebung im Original] Herzmuskelschwäche sowie eine starke Reduzierung des Allgemeinzustandes mit Schwächezustände bestanden“ hatte. Unter Berücksichtigung des Verlusts des rechten Auges wurde ihm 1955 schlussendlich eine Erwerbsminderung von 50 Prozent zugestanden. Weiterhin wurde als erwiesen angesehen, dass Bruno Splitts „soziale und wirtschaftliche Stellung“ in der Vorkriegszeit der eines „mittleren Beamten“ entsprach. Diese wurde der Bemessung seiner Rentenhöhe zugrunde gelegt. Mit dieser individuellen Entschädigungsleistung wurde angestrebt die durch die „Verfolgung beschädigte Biographien und soziale Positionen in gewissen Umfang zu restaurieren.“ Darüber hinaus erhielt er eine „Geldentschädigung für Freiheitsentziehung“ von 19 200 DM. Das Verfahren endete im März 1957 mit der Anpassung an die Bestimmungen des am 29. Juni 1956 erlassenen „Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung“ (BEG). | |||
In der Nachkriegszeit wurde Bruno Splitt mehrfach im Vorfeld diverser juristischer Verfahren gegen verschiedene SS-Angehörige zu seiner Haftzeit in Sachsenhausen befragt. Im August 1961 geschah dies im Zuge laufender Ermittlungen gegen SS-Scharführer Otto Kaiser (1913-1996) und Friedrich Meyerhoff (1916-1987). Beide waren Block- und Kommandoführer in Sachsenhausen. Gegen Meyerhoff lief ab 1959 in Köln ein Verfahren wegen dessen Beteiligung an der Ermordung sowjetischer Kriegsgefangener. Die Ermittlungen mündeten 1964 zu einem ersten Sachsenhausen-Prozess gegen die beiden genannten Täter. Zu den Beschuldigungen gegen die beiden konnte Splitt aber keine weiteren Angaben machen. In einer zweiten Zeugenvernehmung am 13. Oktober 1968 wurde Splitt über den Lagerarzt Dr. Ludwig Ehrsam befragt. Splitt gab an, dass er sich lediglich an dessen Namen erinnern könnte, aber Genaueres könne er nicht berichten. Diese Zurückhaltung ist bemerkenswert, da Ehrsam, der zunächst SS-Arzt zunächst in Dachau und dann in Sachsenhausen gewesen war, für seine besonders brutale und inhumane Behandlung der Häftlinge unter dem Namen Dr. Grausam bekannt geworden ist. Zu den Verbrechen, die im Zusammenhang mit dem Schuhläuferkommando begangen wurden, konnte Splitt ebenfalls nichts zu Protokoll geben. Die Angehörigen des SS-Kommandanturstabs stellten sich den Häftlingen gewöhnlich nicht namentlich vor, sodass die Namen von den Häftlingen untereinander weitergegeben wurden. Dies führte verständlicherweise auch oft zu Verwechslungen und erschwerte die Zuordnung der begangenen Gräueltaten in der juristischen Aufarbeitung in der Nachkriegszeit oft erheblich. | |||
Wie Bruno Splitt seine letzten Lebensjahre verbrachte ist ungewiss. Eine neue Ehe ging er nicht ein und Kinder hatte keine. Ob er sich in der Nachkriegszeit erneut politisch betätigt, ist ebenso nicht bekannt. Es ließen sich keine Genoss*innen ausfindig machen, die ihn persönlich gekannt haben und etwas hätten berichten können. Vielleicht hat er sich ins Private zurückgezogen, um seine Ansprüche im Wiedergutmachungsverfahren nicht zu gefährden. Ebenso erscheint es möglich, dass er mit seiner Vergangenheit abschließen wollte. Bruno Splitt starb am 21. April 1981 in Hof. | |||
|etatEn=Draft | |etatEn=Draft | ||
|etatDe=Entwurf | |etatDe=Entwurf | ||
|etatFr=Brouillon | |etatFr=Brouillon | ||
}} | }} | ||
Version du 6 octobre 2021 à 11:26
| Bruno Splitt | |
|---|---|
| Prénom | Bruno |
| Nom | Splitt |
| Sexe | masculin |
| Naissance | 4 septembre 1898 (Graudenz, Westpreußen) |
| Décès | 21 avril 1981 (Hof, Bayern) |
| Profession du père | Schuhmacher |
Der kommunistische Widerstandkämpfer Bruno Splitt (1898-1981) ist eines der NS-Opfer, die man sicher nicht in der Psychiatrischen Klinik der RUS erwarten würde. Er war seit Beginn der 1920er Jahre in der Arbeiterbewegung des Ruhrgebiets aktiv. Zur Zeit der Machtübernahme führte er seine Tätigkeiten in veränderter Form im Untergrund fort und wurde in Reorganisationsphase der KPD eine zentrale Figur des kommunistischen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus in Essen. Unablässig den Repressionen des NS-Regimes ausgesetzt, führte sein Weg über insgesamt fünf Konzentrationslager schließlich ins KZ Natzweiler-Struthof im Elsass. Von dort aus wurde er zur augenärztlichen Behandlung in der Psychiatrischen Klinik der RUS aufgenommen, was zunächst erstaunt, aber aus reinen Sicherheitsgründen geschah. Bruno Splitt war einer von insgesamt 18 bis jetzt identifizierten Natzweiler-Häftlingen, die in der RUS behandelt wurden. Seine Biographie steht exemplarisch für diese ungewöhnliche Verbindung zwischen dem Konzentrationslager und der „Reichsuniversität“.
Biographie
Essen im Sommer 1933. „Weil ich aber bald merkte, daß ich festgenommen werden sollte, wurde ich flüchtig. [...] Ich hielt mich innerhalb des Stadtgebiets verborgen. Ich habe mal 8 Tage hier und mal 8 Tage dort gewohnt, es kann auch sein, daß ich manchmal an einer Stelle länger gewohnt habe.“ So schilderte der kommunistische Widerstandkämpfer Bruno Splitt seine Zeit im Untergrund. Viel mehr ist über diesen Lebensabschnitt Bruno Splitts aus den Quellen nicht zu erfahren – außer, dass er quasi seit dem Frühjahr 1933 wie viele seiner Genoss*innen ständigen Repressionen ausgesetzt war. Im Juni 1933 war ein Haftbefehl gegen ihn erlassen worden, sodass er jederzeit damit rechnen musste, festgesetzt zu werden. Ein Blick auf die Geschehnisse in Essen, eine Hochburg der Arbeiterbewegung im Ruhrgebiet, lässt erahnen, was das für ihn persönlich bedeutet haben muss. Der nationalsozialistische Terror nach der Machtergreifung manifestierte sich täglich aufs Neue. Vor Übergriffen, Gefangennahmen und Folter konnte keiner der organisierten Arbeiter*innen mehr sicher sein. Die Gefängnisse waren hoffnungslos überfüllt und viele verschwanden in den neu entstehenden KZs. In Bochum wurden mehrere KPD-Funktionäre in einer SA-Kaserne physisch misshandelt, schwerverletzt durch die Straßen geschleppt und schließlich dort in der Öffentlichkeit liegen gelassen. Auch vor Mord schreckte die SA nicht zurück: Nach der Zerschlagung der Gewerkschaften am 2. Mai 1933 fanden Spaziergänger*innen die Leichen von vier Funktionären des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbunds im Wasser. Damit seien nur einige wenige Beispiele genannt, die die Realität des Terrors widerspiegeln. Der gewaltvolle Umgang der Gestapo mit verhafteten Genoss*innen dürfte Bruno Splitt sicher nicht verborgen geblieben sein und muss mit den fortwährenden Repressionen eine psychisch höchst belastende Atmosphäre der Angst geschaffen haben. Diese Situation spitzte sich im Oktober 1933 noch erheblich zu, als von der Polizei in Essen im großen Umfang Fahrradkontrollen durchgeführt wurden, bei denen sich die betreffende Person ausweisen musste. Um Bruno Splitt eine falsche Identität zu verleihen und damit vor der drohenden Verhaftung zu bewahren, übergab ihm seine Frau Hedwig den Militärpass seines Bekannten mit dem Namen Fritz Kleta (geb. 1.02.1895 in Berlin-Steglitz, - ?). Dies konnte Bruno Splitt jedoch nicht schützen, er wurde in Essen-Bottrop im Dezember 1933 festgenommen. Die Polizei fand den Ausweis bei ihm, den er wohl nicht verwendet hatte. Es ist denkbar, dass die Polizei genau wusste, wie der Gesuchte aussah – die entsprechende Akte enthält ein ziviles Passfoto von Bruno Splitt.
Arbeiterbewegung und kommunistischer Widerstand in Essen
Bruno Splitt wurde am 4. September 1898 in Graudenz (damals Westpreussen, heute Polen) als Sohn des Schuhmachers Ernst und dessen Ehefrau Pauline Splitt geboren. Über seine Kindheit ist fast nichts bekannt. Von 1907 bis 1912 besuchte er die Grundschule, vermutlich in seinem Geburtsort. Danach zog er nach Essen. Dort angekommen, war Bruno Splitt zuerst als Laufbursche und dann als Lagerist bei der Firma Grubenbecker beschäftigt. Von 1916 bis 1917 arbeitete er als Presser bei der Firma Thyssen. Vom September 1917 bis Juli 1919 war er zum Heeresdienst eingezogen, vom Januar 1918 bis 9. April 1918 befand er sich an der Westfront. Bei den langen Märschen traten gesundheitliche Probleme an seinen Füßen auf und er wurde zurück nach Deutschland zum „Landsturm“ in Schlettstadt im Elsass (heute frz. Sélestat) versetzt. Nach Ende des Ersten Weltkrieges und der Demobilisierung arbeitete er zunächst in einer Kohlefabrik in der Nähe der Essener Zeche Wolfsbank. Er war zusammen mit Ernst und Emil Splitt in der Germaniastraße 71 in Essen gemeldet. Bei erstgenanntem handelt es sich definitiv um seinen Bruder, bei zweitgenanntem ist dies ebenso denkbar. In dieser Zeit engagierte Bruno Splitt sich erstmals politisch. Er organisierte sich 1919 gewerkschaftlich im „Bergarbeiterverbund Deutschland“ und trat im Oktober 1920 der USPD bei, um nach deren zunehmenden Verfall und Machtverlust der neu gegründeten KPD anzugehören. Bruno Splitt war danach mehrfach bei der Firma Krupp in Essen beschäftigt (Abb. 2).
Zunächst arbeitete er ab dem 16. Oktober 1920 dort als Hilfsarbeiter, bis er aufgrund von „Arbeitsmangel“ am 23. November 1923 vermutlich im Zuge der Hyperinflation und der gleichzeitigen französisch-belgischen Ruhrbesetzung entlassen wurde. Ähnliches wiederholte sich nachdem er am 25. Juli 1927 eingestellt und am 18. September 1929 vermutlich aufgrund der sich zuspitzenden Weltwirtschaftskrise entlassen wurde. Zwischenzeitlich fand er als Bergmann auf der Zeche Carolus Magnus, einem Steinkohlebergwerk in Essen-Bergeborbeck wieder Arbeit. Diese Stelle verlor er aufgrund eines Arbeitsunfalls, bei dem er sich den linken Daumen brach. Es folgten einige Jahre der Arbeitslosigkeit währenddessen er von „Erwerbslosenunterstützung“ lebte. In dieser Zeit wendete er sich vermehrt der Politik zu. Bereits seit 1927 war er als Unterkassierer und Org.-Leiter der KPD für den Essener Stadtteil Borbeck tätig. Diese Funktion übte er bis zum 1. März 1933 aus. Er geriet zunehmend durch seine politischen Aktivitäten ins Visier der Polizei. Am 29. Oktober 1929 nahm Bruno Splitt an einer Demonstration gegen das Verbot des paramilitärischen Roten Frontkämpferbundes (RFB) teil. Er wurde verdächtigt, einer der ebenfalls verbotenen Nachfolgeorganisationen anzugehören, weswegen er verhaftet wurde. Das zuständige Schöffengericht sprach ihn jedoch am 21. August 1930 von allen Vorwürfen frei. Am 27. Mai 1930 heiratete Bruno Splitt die Hausangestellte Hedwig Frieda Johanna Rittelmeyer (geboren am 26. Mai 1909 in Essen-Borbeck). Zum Zeitpunkt seiner Hochzeit waren seine Eltern, die in Graudenz verblieben waren, bereits verstorben.
Bruno Splitts Trauzeuge war der mit ihm Verwandte Bergmann Emil Splitt. Am 21. März 1931 war Splitt in eine „politische Schlägerei“ verwickelt, die eine Verurteilung zu einer Geldstrafe von 20 RM und 4 Tagen Gefängnis wegen gefährlicher Körperverletzung am 24. Juli 1931 verurteilt. Im gleichen Jahr wurde gegen ihn wegen des Tragens einer Armbinde mit der Aufschrift „Roter Helfer“ ein Erfahren eingeleitet, dass aber im September 1931 eingestellt wurde. Immer wieder leitete Splitt im Essener Stadtteil Borbeck Versammlungen und Kundgebungen der KPD, besonders häufig im Lokal „Brück“. Sein politisches Engagement beschränkte sich nicht auf die Ebene der Parteiarbeit und praktische Aufgabenbereiche. Zu Beginn der 1930er Jahre hat Splitt an einen Kurs an der internen Reichsparteischule Rosa-Luxemburg in Fichtenau (Baden-Württemberg) teilgenommen. Diese diente zur Vermittlung und Diskussion der marxistisch-leninistischen Philosophie und schloss auch die Lektüre des Kapitals und anderer Schriften von Marx sowie Lenin und anderen mit ein. Außerdem wurden die Geschichte der Arbeiterbewegung und Strategie und Praxis der politischen Arbeit thematisiert und ein Erfahrungsaustausch unter den Kommunist*innen angeregt. Die Seminarist*innen wurden von Parteikoryphäen wie Hermann Duncker, Karl- August Wittvogel und Ernst Scheller unterrichtet. Regelmäßig hielten dort auch Wilhelm Pieck und Ernst Thälmann Vorträge. Wen Bruno Splitt dort persönlich getroffen hat, muss offenbleiben. Die Teilnehmer*innen hatten vorab eine Lektüre zur Vorbereitung zu lesen und sich durch eine eingereichte Hausarbeit für die Teilnahme zu qualifizieren. Die Atmosphäre des Ortes wurde von Zeitzeug*innen als von „Lernbegeisterung“ und der „Macht des Wissens“ geprägter Ort beschrieben. Bruno Splitts politische Karriere in der Weimarer Republik fand ihren Höhepunkt mit seiner Wahl 1932 zum Stadtverordneten in Essen. Es gehörte nun zu seinen Aufgaben, Versammlungen der Partei zu leiten, so organisierte in führender Position im Dezember 1932 den Unterbezirksparteitag der KPD in Essen.
Wie eingangs bereits deutlich wurde, erfuhr die politische Arbeit Bruno Splitts mit der Machtergreifung eine tiefe Zäsur. Er arbeitete mittlerweile wieder als Bergmann und wohnte in Essen-Fintrop im Graffweg 19. Die Nachricht über die Regierungsbildung am 30. Januar 1933 veranlasste die Menschen in vielen Teilen des Ruhrgebiets dazu, auf der Straße ihrer Empörung Ausdruck zu verleihen. Auch in Essen-Borbeck fanden Demonstrationen statt, bei denen gut denkbar ist, dass Bruno Splitt daran teilnahm. Die NSDAP erreichte bei den Reichstagswahlen im März 1933 auch in Essen mit 30,6 Prozent der abgegebenen Stimme auf dem demokratisch-legalen Weg keine Mehrheit. Die Bezirksleitung Ruhrgebiet der KPD erklärte daraufhin in einem Rundschreiben: „Die Entwicklung des Faschismus in der Vergangenheit trug mehr einen quantitativen Charakter. Die Kette der terroristischen Bluttaten und Mordakte... [...] Nunmehr aber mit der legalen Einbeziehung der Nazis und Stahlhelmer in den Staatsapparat beginnt der Umschlag in die qualitative Entwicklung des Faschismus in der Linie des legalen, wohldurchdachten, zentralen und organisierten Einsatzes der faschistischen Terrorformation.“ In den Gemeindewahlen am 12. März 1933 entfielen auf die NSDAP genau 31 Mandate. Auch hier bedeute dies keine Mehrheit, die sich die Nazis nun aber auf gewaltsamen Weg aneignete, indem sie die 12 Mandate der KPD ersatzlos streichen ließ. In den Monaten nach der Machtergreifung war Splitt weiter in der Verwaltung von Finanzen und Kassieren sowie auch beim „Vertrieb von Flugblättern“ involviert. Wie Bruno Splitt diese Zeit persönlich erlebt hat, bleibt im Dunkeln. Aber die Schilderungen über die Geschehnisse in den Arbeitervierteln Essens lassen erahnen, in welch bedrohlicher Situation seine Genoss*innen und er sich befunden haben müssen. Die SS, SA und Polizei umzingelte mehrfach die Häuserblocks der Arbeiter*innen, die als „Zentren des politischen Widerstandes“ gegen die Nationalsozialisten galten und durchsuchten sie Haus für Haus, wobei prominente Personen verhaftet wurden. Man versuchte der organisierten Arbeiterschaft zuzusetzen, indem „politische Bücher und Zeitungen“ bis hin zu „Sportgeräte und Musikinstrumente der Arbeiterkulturorganisationen“ entwendet wurden. Derartige Razzien fanden in verschiedenen Stadtteilen Essens vom Frühjahr bis September 1933 statt. Die Arbeiterbewegung beantwortete dies mit mannigfaltigen Widerstandsaktionen. Eine der kreativsten Protestakte bestand darin, über Nacht einen weithin sichtbaren „Rot Front“-Schriftzug an einem zentral gelegenen Bürohaus anzubringen. Ob und wie sich Bruno Splitt an diesen oder ähnlichen Aktionen beteiligte, ist unklar. Fest steht jedoch, dass Bruno Splitt nicht davon abließ, die Organisationsstruktur der KPD zu reorganisieren und deren Handlungsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Dies blieb nicht ohne Konsequenzen. Das Amtsgericht in Essen erließ am 11. Juli 1933 Haftbefehl gegen Bruno Splitt. Er wurde beschuldigt im Mai des gleichen Jahres „gemeinschaftlich mit Anderen handelnd, es unternommen zu haben, die Verfassung des Deutschen Reiches gewaltsam zu ändern, durch dieselbe Handlung anders, ein hochverräterisches Unternehmen vorbereitende Handlungen unternommen zu haben, - Verbrechen gegen §§ 81, Z. 2, 86, 47, 73 St.G.B. [...] Fluchtverdacht ist gesetzlich begründet, da ein Verbrechen Gegenstand der Untersuchung bildet. Auch besteht mit Rücksicht auf die Teilnahme mehrerer Verdunklungsgefahr.“ Schließlich wurde Bruno Splitt am 11. August 1933 mit vier anderen Kommunisten angeklagt, die im oben zitierten Haftbefehl genannten Verbrechen im April des gleichen Jahres begangen zu haben. Zum Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung saßen Bruno Splitts mitangeklagte Genossen alle in Untersuchungshaft, er selbst konnte sich noch vor dem Zugriff der Polizei versteckt halten. Aus der Perspektive der Essener Polizei war Bruno Splitt „kommunistischer Funktionär“ und „fanatischer Anhänger der kommunistischen Ideen“. Bruno Splitt initiierte laut der Urteilsbegründung zufolge im April 1933 die Verbreitung von verschiedenen Flugblätter und Zeitschriften der KPD. Er soll 40 Exemplare an seinen Genossen Johann Klaus zur weiteren Verteilung übergeben haben. Die Drucksachen informierten über die Repressionsmaßnahmen des NS-Regimes, forderten eine Freilassung Ernst Thälmanns und aller anderer Inhaftierten. Ebenso waren der Aufruf zur Organisation der Arbeiterbewegung und Widerstand Thema. In der Anklageschrift wurde die Verteilung der Schriften als „Vorbereitung zum Hochverrat“ gewertet, da die KPD die Errichtung einer „Rätediktatur des Proletariats nach sowjet-russischem Vorbild“ anstrebte. Im Sinne der Anklage wurden alle seine Genossen als schuldig befunden und erhielten Zuchthausstrafen von einem Jahr und neun Monaten. Bruno Splitt wird in dem Urteil nicht erwähnt, da er sich wie eingangs beschrieben zunächst versteckt halten konnte. Nach seiner Verhaftung wurde er ins Essener Untersuchungsgefängnis verbracht. Seine Frau Hedwig besuchte ihn dort einige Tage vor Weihnachten 1933. Wann und ob er seine Frau danach nochmals wiedergesehen hat, ist ungewiss.
Die Widerstandgruppe um Bruno Splitt hatte sich im Jahr 1933 offensichtlich nicht von den massiven Repressionen einschüchtern lassen und ihre Arbeit fortgesetzt. Nach seiner Verhaftung wurde er im Jahr 1934 nun dafür erneut juristisch verfolgt und stand zusammen mit 83 anderen Kommunist*innen wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ vor Gericht. Der Zusammenschluss hatte die Vervielfältigung von Schriften und deren Verteilung wiederaufgenommen. Im Zuge der Ermittlungen wurden eine Schreibmaschine, ein Vervielfältigungsapparat und diverse Druckschriften und Flugblätter von der Polizei beschlagnahmt. Schenkt man den Ergebnissen der polizeilichen Untersuchungen Glauben, dann sah Bruno Splitts Tätigkeit im kommunistischen Widerstand nach der Machtübernahme folgendermaßen aus. Splitt stand neben zwei anderen Angeklagten an der „Spitze der Organisation“ und war ununterbrochen in Essen politisch aktiv. Im Wortlaut der Anklageschrift bezeichneten die anderen aus der Gruppe Bruno Splitt als den „Macher“, der die Initiative ergriff, die unterschiedlichen Aufgabebereiche miteinander vernetzte und auch andere zur Mitarbeit bewegen konnte. Die Region des Ruhrgebiets wurde bei dem Versuch ein Widerstandsnetz aufzubauen in sechs sogenannte „Instruktionsgebiete“ aufgeteilt. Die Stadt Essen entsprach dem „Bezirk II“ und war wiederum in vier „Unterbezirke“ aufgegliedert: Altessen, West, Mitte und Kray-Steele. Laut der Urteilsbegründung hatte bei dieser Reorganisationsphase Bruno Splitt „eine besondere Rolle“ gespielt. Er habe nach der Machtübernahme seine bereits seit Oktober 1932 wahrgenommene Tätigkeit als „Orgleiter des Unterbezirks Groß-Essen“ im Untergrund wiederaufzunehmen und die „Organisation der KPD [...] wiederherzustellen. Er sei in den verschiedenen Stadtteilen Essens „eifrig tätig“ gewesen. Seine Aufgabe sein es gewesen Genossen zur „illegalen Tätigkeit und zur Übernahme von Funktionärsposten“ wie beispielsweise als „Kassierer“ einzuteilen und zu motivieren. Damit hatte er der Urteilsbegründung zufolge bereits direkt nach der Machtergreifung begonnen. Er war maßgeblich an der Organisation der Verbreitung von „Informations- und Propagandamaterial“ beteiligt. Es folgten regelmäßige Treffen mit diversen Genoss*innen. Es sei ihm dadurch gelungen „in fast allen Stadtteilen Funktionäre für die KPD“ zu gewinnen und die „alte Organisation zu beleben“. Er soll beispielsweise die Einrichtung einer „Postanlaufstelle“ im Mai oder Juni 1933 initiert haben, die zum Dreh- und Angelpunkt der Vervielfältigung und Verteilung der Flugschriften werden sollte. Die Gruppe schaffte es, mehrere tausend Flugblätter herzustellen und zu verbreiten. Weiterhin wurde Geld zur Unterstützung u. a. von inhaftierten Mitgliedern der KPD und deren Familien gesammelt. Auch die Organisation der illegalen Tätigkeit war ohne finanzielle Mittel nicht möglich. Die Bezirksleitung Ruhrgebiet rief dazu auf, regelmäßig die Beiträge zu entrichten, denn „jeder Pfennig ist heute Munition.“ Die Einnahmen beliefen sich beispielsweise im Herbst 1933 monatlich auf rund 1000 RM, das zeitgenössisch als „Opfermut“ der Widerstandkämpfer*innen gedeutet wurde – waren doch viele von ihnen arbeitslos. Auch übernahm Splitt erneut die Funktion eines Funktionärs im Unterbezirk von Essen, die er angeblich wegen eines „Nervenzusammenbruchs“ im Juli 1933 zwischenzeitlich aufgegeben haben soll. Es liegt nahe, dass er diesen als Reaktion auf den Haftbefehl erlitten hat. In einer Zusammenkunft mit anderen Angeklagten am 13. November 1933 wurde geplant, dass er zukünftig als „Polleiter“ das „Instruktionsgebiet Gelsenkirchen“ ebenfalls übernehmen sollte. Durch seine Festnahme kam es anscheinend aber nicht mehr dazu. Am Ende des Verfahrens wurden in der Urteilsverkündung am 19. Oktober 1934 unterschiedliche Strafen verhängt, Bruno Splitt wurde zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt. Dabei wurden ihm acht Monate und zwei Wochen von der Untersuchungshaft angerechnet. Die beschriebe Tätigkeit ist paradigmatisch für die Widerstandsaktivitäten nach dem Übergang der KPD in die Illegalität zum Zeitpunkt des Reichtagbrandes. Da viele der Führungskader verhaftet waren, warten die örtlichen Gruppen nicht lange auf Weisungen und versuchten auf Eigeninitiative hin den „Zusammenhalt [zu] wahren, Gelder [zu] sammeln“ sowie „Informationsmaterialien“ herzustellen und deren Verteilung zu organisieren. Bereits im Vorfeld waren Material wie Druckmaschinen, Matrizen, Schreibmaschinen und Papier an geschützten Orten deponiert worden. Das publizistische Organ der KPD im Wirkungskreise Bruno Splitts war das „Ruhr-Echo“, deren Reproduktion und Verteilung seinen Genoss*innen und ihm in der Anklageschrift zur Last gelegt wurde. Auch wenn dieser Widerstand auf einer weit verbreiteten, fatalen Fehleinschätzung der KPD beruhte, dass das NS-Regime durch ein nur ausreichendes Aufgebot an Gegenwind in absehbarer Zeit geschlagen werden könne, schmälert dies jedoch nicht dem Mut, den Splitt und seine Mitkämpfer*innen aufgebracht haben.
Esterwegen – Sachsenhausen – Natzweiler – Dachau – Neuengamme: Eine Odyssee durch die Konzentrationslager Am 25. Dezember 1935 hatte Bruno Splitt seine Zuchthausstrafe in der Strafanstalt Münster in Westfalen abgesessen. Die Strafanstalt teilte mit, dass er sich „zwar gut geführt hätte“, aber eine „innere Umstellung bei ihm nicht zu erkennen gewesen“ sei. Nach der Einschätzung der zuständigen Gestapo Düsseldorf, Außendienststelle Essen, handelte es sich bei Bruno Splitt um einen „ganz gefährlichen Kommunisten“. Der zuständige Strafanstaltsdirektor in München bezeichnete Splitt darüber hinaus als „Großmaul“. Daher wurde er über das Gefängnis in Essen in Schutzhaft ins KZ Esterwegen eingewiesen. Die von der Gestapo Essen und dem KZ verfassten Schreiben und Beurteilungen anlässlich anstehender „Haftprüfungstermine“ waren Ausdruck der Willkürherrschaft und lesen sich wie bloße Makulatur. Fast gänzlich unabhängig von Bruno Splitt „Führung“ im Lager und egal wie oft er die Aussage tätigte, er wolle sich politisch nicht mehr betätigen – einem einstweilen „rührigen Kommunisten“ glaubte man nicht und die Schutzhaft wurde mehrfach verlängert. Die Rekonstruktion der folgenden Odyssee durch die Konzentrationslager bleibt leider auf die rudimentären Dokumente aus der Täterperspektive beschränkt. Auch in den zahlreich vorliegenden Gesprächen mit Überlebenden der unterschiedlichen KZs blieb die Person Bruno Splitt unerwähnt. Damit bleiben die Fragestellungen, die sich auf das persönliche „Erleben“ und die „Wahrnehmung“ Bruno Splitts innerhalb der „(Zwangs-)Gesellschaft Konzentrationslager“ beziehen, unbeantwortet. Eine Annäherung an seinen Alltag wurde durch den Rückgriff auf allgemeinere Literatur versucht.
Als das Schutzhaftlager Esterwegen im Sommer 1936 aufgelöst wurde, wurden die Häftlinge in das neu entstehende KZ Sachenhausen bei Oranienburg im Norden von Berlin verlegt. Bruno Splitt wurde in Sachsenhausen unter der Häftlingsnummer 000373 als Schutzhäftling registriert und zunächst im Häftlingsblock 5 und später in den Blöcken 12, 18 und 23 untergebracht. In Sachenhausen begann der Aufbau des KZ mit der Rodung eines 80 Hektar großen Waldstücks. Im folgenden Jahr wurden rund 100 Gebäude von den Häftlingen errichtet, darunter Häftlingsbaracken, SS-Kasernen, Wirtschaftsgebäuden und SS-Siedlungshäuser. Bruno Splitt hingegen war im Jahr 1936 als „Stubenältester, Blockeinkäufer und später Lagereinkäufer“ tätig und hatte damit in der Lagerhierarche als Funktionshäftling eine recht privilegierte Position. Im Frühjahr 1938 wurden in Sachsenhausen die unterschiedlichen Häftlingswinkel eingeführt. Bruno Splitt wird als „Schutzhäftling“ sehr wahrscheinlich einen roten Winkel getragen haben.
Während Bruno Splitt im KZ Sachenhausen interniert war, floh seine Frau Hedwig Splitt mit einem Touristenvisum über Amsterdam nach Brüssel, wo sie irgendwann im Januar oder Februar 1937 ankam. Dort wurde sie zunächst als politischer Flüchtling registriert, wobei dieser Status in den kommenden Jahren immer wieder von den Behörden in Frage gestellt wurde. Zunächst erhielt sie nur eine befristete Aufenthaltsgenehmigung bis zum Ende März 1937. Gegenüber den Behörden gab Hedwig Splitt an, dass sie „wegen politischer Arbeit“ geflüchtet sei, sie gehöre seit 1934 der „Trotzky [?]-Bewegung“ an. Sie habe Belgien gewählt, „weil meine Freunde hier sind“. In Brüssel wohnte sie bei der Belgierin Nora Sachse, die sie in ihren Angelegenheiten unterstützte, vermutlich einer der genannten Freunde. In einem anderen Fragebogen wiederum beantwortete Hedwig Splitt die Frage nach dem Grund für ihre Flucht folgendermaßen: „wegen illegaler Tätigkeit“ und „Beihilfe zur Flucht“. Um welche Flucht es sich handelte, bleibt unklar. Weiterhin beabsichtigte in Belgien zu „arbeiten, wenn es geht“. Die letzten Unterlagen, die sich erneut um ihren Aufenthaltsstatus drehen, datieren auf das Jahr 1941. Danach verliert sich ihre Spur.
Illustration rosa Schutzhaftbefehl Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland, RW 0058 (Geheime Staatspolizei – Staatspolizeileitstelle Düsseldorf), Nr. 927 ( JPEG 0063)
Nach insgesamt dreijähriger Haft wurde Bruno Splitt kurz vor Weihnachten, am 21. oder 23. Dezember 1938 aus Sachenhausen entlassen, was in dieser Zeit nicht unüblich war. Nach seiner Freilassung arbeitete er als Bergmann auf der Zeche Carolus Magnus, einem Steinkohlebergwerk in Essen-Bergeborbeck. Seine Zeit in Freiheit war nicht von langer Dauer. Im Zuge der „Aktion 1.9.1939“ wurde er auf seiner Arbeitsstelle erneut festgenommen. Bruno Splitt gab in der Nachkriegszeit an, vom 8. September 1939 an erneut in Sachsenhausen gewesen zu sein. Damit gehörte er zu den rund 800 deutschen Männern, die von der Gestapo „nach lange vorbereiteten Listen“, die sogenannte Aktion „A-Kartei“ als politische Gegner nach Kriegsbeginn inhaftiert wurden. Bei dieser zweiten Inhaftierung erhielt er die Nummer 12 146. Im Jahr 1939 war er zunächst im „Lagerbau – SS-Siedlung – „tätig und anschließend seit Februar 1940 als „Einkäufer für den Krankenbau“. Er ist während seiner Haftzeit mehrmals erkrankt. Vom 21. Oktober 1940 bis 4. November 1940 wurde er wegen einer Phlegmone und erneut vom 10. Februar 1941 bis 18. März 1941 wegen einer Phlegmone am Knie behandelt. Dies belegt auch eine Liste zum Zugang im Krankenbau am 10. Februar 1941. [Behandlung in den Häftlingskarten Arolsen unleserlich]
Am 2. Oktober 1940 wurde er einer Strafkompanie zugewiesen, da ihn ein Häftlingssanitäter beim Blockführer dieser Strafkompanie denunzierte und angab, Splitt hätte „illegale Geschäfte mit Kantinenware“ betrieben. Damit verlor Splitt zunächst seine privilegierte Position als Funktionshäftling. Dies könnte im Zusammenhang mit Streitigkeiten der Häftlingsgruppen „Politische“ und „Kriminelle“ stehen, die um diese Posten konkurrierten. Die Häftlinge dieser Strafkompanie wurden besonders harten Arbeitskommandos zugeteilt. In Zusammenhang mit den „ständigen Misshandlungen“ bedeutete dies für viele den Tod. Zusätzlich erhielt Splitt „50 Stockschläge, 2 Stunden Pfahlhängen und 14 Tage Zellenbau“ seitens der Lagerleitung. Dies waren typische „Lagerstrafen“, die viele Häftlinge nicht überlebten. Die physiologischerweise gut durchbluteten Nieren wurden bei diesem Gewaltakt häufig derart in Mitleidenschaft gezogen, dass die Häftlinge schlichtweg verbluteten. Der niederländische Häftling Ab Nicolaas berichtete, dass nach der Prügelstrafe der „kaputtgeschlagene Hintern“ mit Hilfe von eigens zu diesem Zweck aufbewahrten „Margarineverpackungen“ „ganz vorsichtig“ behandelt worden wäre. Es ist denkbar, dass die Strafe im Zellenbau vollstreckt wurde oder später auch lageröffentlich auf dem Appellplatz. Diesen Zellenbau ließ die SS Anfang 1937 errichten. Es handelte sich um ein T-förmiges Gefängnisgebäude mit 80 Zellen. Die SS vollstreckte in dem Gebäude Strafen und führte Verhöre durch. Zum dem Zeitpunkt als Bruno Splitt misshandelt wurde, geschah dies noch durch die SS selbst. Ab August 1942 wurden Mithäftlinge gezwungen die Prügelstrafe zu vollziehen. Nach Verbüßung dieser drakonischen Strafe wurde Bruno Splitt im November 1940 für fünf Wochen dem berüchtigten „Schuhläuferkommando“ zugeteilt, dem er etwa fünf Wochen angehörte. Seit dem Sommer 1940 wurden die Häftlinge dieses Strafkommandos gezwungen im Auftrag der Schuhindustrie die Sohle der Schuhe zu testen. Dies fand auf einer eigens dafür eingerichteten „Schuhprüfstrecke“ statt, die um den Appellplatz des Lagers herum führte. Bei jeder Witterung mussten die Häftlinge täglich bis zu 40 Kilometer in strammen Schritt im Kreis gehen. Wer dem nicht nachkommen konnte, wurde von der SS misshandelt. Bruno Splitt war einer der wenigen, der diese Torturen über die fünf veranschlagten Wochen überhaupt überlebte. Die restliche Zeit in der Strafkompanie bis zu seiner Verlegung nach Natzweiler am 20. Mai 1941 gehörte Bruno Splitt anschließend dem sogenannten Lorenkommmando an. Aus einem ärztlichen Gutachten in der Nachkriegszeit ist bekannt, dass Splitt im Winter 1939/40 erstmals an „Schwächezustände[n]“ und Herzanfälle[n]“ litt. Dies ist nicht verwunderlich, da dieser Winter als der erste „Hungerwinter“ in Sachsenhausen bezeichnet wird. Ende 1939 hatte sich die Lage angesichts der Masseneinlieferungen seit Kriegsbeginn drastisch verschlechtert. Wegen der wachsenden Häftlingszahlen wurden die Essensrationen mehrfach verkürzt und der alltägliche Terror der SS nahm zu. So mussten viele Arbeiten beispielsweise im Laufschritt erledigt werden.
KZ Natzweiler und die Behandlung in der RUS Am 22. Mai 1941 endete Bruno Splitts Internierung in Sachsenhausen, wo insgesamt rund 200.000 Häftlinge inhaftiert waren. Davon überlebte nur ungefähr die Hälfte den täglichen Terror. Bruno Splitt war einer von ihnen. Dies bedeutete jedoch keineswegs seine Entlassung. Inzwischen war seit Anfang Mai der Bau des KZ Natzweiler-Struthof im Gange, wohin Splitt am 23. Mai 1941 verbracht und als Politischer Häftling mit der Nummer 230 registriert wurde. Er war damit Angehöriger des zweiten von insgesamt zwei Aufbau-Transporten, die Sachsenhausen verließen. Josef Kramer (10.11.1906 – 13.12.1945), der seit April 1941 Schutzhaftlagerführer in Natzweiler war, war zuvor nach Sachsenhausen gereist, um dort 300 langjährige Häftlinge zu diesem Zweck auszuwählen. Damit ist anzunehmen, dass Splitt als Funktionshäftling in Natzweiler vorgesehen und eingesetzt worden ist. Laut dem Effektenverzeichnis gab er bei der Einlieferung einen Hut, eine Jacke, eine Hose, vier Hemden, 1 Unterhose, drei Paar Strümpfe und ein Paar Schuhe ab. Seine „bevorzugte Post“ erhielt er von seinem Bruder Ernst Splitt aus Essen (damals wohnhaft Zweigstraße 11). Pro Kalendermonat erhielt und schrieb er mehrere Briefe. Über den persönlichen Alltag Splitts in Natzweiler ist fast nichts bekannt. Am 16. April 1943 erlitt Bruno Splitt in einen „Arbeitsunfall“, bei dem er sich eine „empfindliche Augenverletzung“ zuzog. Konkret handelte es sich um einen „Metallsplitter im rechten Auge“. Dieser Unfall hat soll sich in der „Häftlingsküche“ ereignet haben. Die Dokumente, die von der nachfolgenden Behandlung Splitts zeugen, sind alle von dem Lagerarzt und SS-Obersturmführer Franz von Bodman (auch Bodmann; 23.3.1908 – 25.5.1945) unterzeichnet. Bodmann ordnete an, dass Splitt am 19. April 1943 zur ambulanten Behandlung in der Augenklinik der „Reichsuniversität“ Straßburg eingewiesen wurde, um den Fremdkörper dort operativ entfernen zu lassen. Der Eingriff verlief offenbar nicht erfolgreich. Am 23. April wurde Brno Splitt zur „Enukleation des rechten Auges“ erneut in die RUS aufgenommen; diesmal war eine stationäre Behandlung notwendig. Um eine Flucht aus den zivilen Krankenanstalten zu vermeiden, wurde er in der Psychiatrischen Klinik (Station 58) untergebracht. „[W]eil in der Augenklinik keine Überwachung möglich war“, wie dort in Splitts Krankenakte notiert wurde. Dies war offenbar die gängige Verfahrensweise bei stationären Behandlungen von KZ-Häftlingen in der RUS. Dies legte eine handschriftliche Notiz des Lagerarztes Dr. Schiedlausky auf der Rückseite des Antrags zur Krankenhausbehandlung eines weiteren KZ-Häftlings aus Natzweiler nahe. Dort heißt es:
„1) Sicherheit regeln: nach bisheriger Durchführung sollen die Häftlinge in einer Zelle der psych[iatrischen] Abt[ei]l[ung] untergebracht werden. Wer übernimmt die Sicherheit bei Vorführung zur Behandl[un]g oder kann diese in der Zelle zur Durchführung kommen wie bei dem Häftling Splitt?“
Gemeint ist die abschließbare Zelle in der psychiatrischen Klinik, die normalerweise zur Isolierung von psychomotorisch erregten und „gewalttätigen“ Patient*innen diente. Die ärztliche Dokumentation in der Psychiatrie beschränkte sich auf Folgendes „Da aus K.Z. Natzweiler, für die Dauer seiner Behandlung in der Augenklinik [...] hier in Verwahrung. Verhielt sich ruhig, unauffällig.“ Am 30. April 1943 wurde Splitt wieder zurück nach Natzweiler verbracht. Am 14. Mai 1943 wurde Splitt vom Lagerarzt ein drittes Mal in die RUS „zur Anpassung eines Kunstauges“ überwiesen. Die Überweisung erfolgt unter der Bereitstellung eines „Begleitposten“, der vermutlich für die Überwachung Splitts abgestellt wurde. Für die gesamte Behandlung und auch die Bezahlung des Glasauges kam die Lagerverwaltung auf. Angesichts dieser relativ privilegierten Behandlungsweise liegt der Schluss nahe, dass Splitt Funktionshäftling in Natzweiler war und die SS daher ein Interesse an der Erhaltung seiner Gesundheit und seines Augenlichts hatte. Dafür spricht auch der Umstand, dass er relativ gut mit Nahrungsmitteln versorgt war und sein Gewicht von 1941 bis 1943 relativ konstant um 70-73 Kilo blieb. Das beschriebene Vorgehen war kein Einzelfall. Während des Bestehens der RUS wurden dort insgesamt 18 Häftlinge aus dem KZ Natzweiler behandelt [Link zu anderen Bios]. Vergleichbare Fälle finden sich vereinzelt auch in anderen Konzentrationslagern. In Sachsenhausen erhielt der polnische Häftling Tadeusz Rogowski ebenfalls eine Augenprothese, die durch den dortigen Lagerführer besorgt worden war. Auch der Kommunist Ernst Brinkmann wurde nach einer Augenverletzung mit einem Kunstauge versorgt. Eine privilegierte medizinische Behandlung über die rudimentären Versorgungsstrukturen des KZ hinaus, findet sich generell auch in anderen Lagern. Fast 100 Häftlinge aus Sachsenhausen wurden im Staatskrankenhaus der Polizei in Berlin wegen anderer Leiden behandelt. Wer diese Häftlinge waren, ist bisher unbekannt. (Abschließende Einordnung der Verbindung zwischen RUS und Ntzweiler weiteren Forschungen vorbehalten, über 20 Häftlinge dort behandelt...)
Bruno Splitt wurde am 21. September 1944 vor der Auflösung des KZ Natzweiler am 23 November 1944 ins KZ Dachau verlegt und von dort aus am 22. Oktober 1944 in das KZ Neuengamme. Neben Mauthausen in Österreich war Neuengamme das letzte KZ, das sich vor dem unmittelbaren Kriegsende noch im Machtbereich der Nazis befand. Wie Bruno Splitt die letzten Tage der Internierung erlebte und ob er auf einen Evakuierungsmarsch geschickt wurde, ist unbekannt. Am 2. Mai 1945 wurde Neuengamme von den Engländern befreit. Die gesundheitlichen Folgen der jahrelangen Haft begleiteten Bruno Splitt für sein restliches Leben. Bis Weihnachten des gleichen Jahres litt er immer wieder an Schwächezuständen.
Nachkriegszeit Nach der jahrelangen Odyssee durch fünf verschiedene Konzentrationslager zog es Bruno Splitt zunächst zurück nach Essen, wo er ab dem 19. Dezember 1945 in der Zweigstraße 25 gemeldet war. Seine Ehefrau Hedwig hatte den Krieg ebenfalls überlebt. Die beiden fanden offenbar jedoch nicht mehr zusammen und die Ehe wurde am 8. Oktober 1947 geschieden. Bruno Splitt blieb nicht lange in Essen und zog am 08. Mai 1946 nach Goldkronach (Kreis Bayreuth), wo er ab dem 14. Mai 1946 offiziell gemeldet war. Vermutlich hatte sein Umzug berufliche Hintergründe. In Goldkronach angekommen, begann Bruno Splitt bei der Firma „Plantana Heilpflanzen-Anbau-und Verwertungs-GmbH“ als deren Geschäftsführer zu arbeiten. Seine Aufgabe war es u. a. die Abläufe zwischen den „vertraglichen Anbauern von Heilpflanzen“ und den „Sammlergruppen von Wildkräutern“ zu koordinieren. Gesundheitliche Gründe zwangen ihn, diese Stellung am 31. März 1948 aufzugeben. Währenddessen war Splitt bereits am 10. Oktober 1946 nach Hof umgezogen, eine kleine Stadt ebenfalls im Kreis Bayreuth. Vom 1. April 1948 bis zum 30. September 1949 arbeitete er in Hof bei der „Fränkischen Verbandmittelindustrie“ als Geschäftsführer.
Entschädigungsverfahren Am 17. Oktober 1949 stellte Splitt beim „Landesamt für Wiedergutmachung“ einen Antrag und gab als „Körperschäden“ neben dem „Verlust des rechten Auges“ auch eine „Angina pectoris“ an. In der bürokratisch-verschleiernden Sprache seiner Akte werden die Gründe in der „unsachgemässe[n] Behandlung im KZ-Natzweiler“ bzw. in der die „KZ-Haft und die dort angewandten Methoden“ gesehen. Dabei waren Herz- und Kreislaufbeschwerden eine der häufigsten physischen Spätschäden infolge von KZ-Haft. Diesen waren dabei häufig „unabhängig von jeder klinischen, röntgenologischen oder elektrokardiographischen Symptomatik“. Bereits 1947 war ein einen Kuraufenthalt wegen dieser Beschwerden notwendig geworden. Nun beantragte Bruno Splitt ein „Heilverfahren“, eine seines Verdienstausfalls entsprechende Rente und eine „Kapitalentschädigung von 50 000 DM“ für sein verlorenes Augenlicht. Zur Überprüfung wurde ein ärztliches Gutachten im Stadtkrankenhaus in Hof eingeholt, das den kausalen Zusammenhang zwischen seinen Herzbeschwerden und der KZ-Haft infrage stellte. Auch ein weiteres amtsärztliches Gutachten von 1954 kam zu einem ähnlichen Ergebnis und konnte seine Klagen auf keinen „objektiven Befund“ zurückführen. Unabhängig davon wurde seine Erwerbsfähigkeit auf 60 Prozent geschätzt. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete Bruno Splitt stundenweise bei der Firma Schmitt & Co, die „Süsswaren“ vertrieb. Dennoch kam das Gesundheitsamt Hof zu dem Schluss, wenngleich „kein Anhalt für einen Herzmuskelschaden“ auszumachen sei, dass man „zu seinen Gunsten annehmen muss, dass durch die langjährige KZ-Haft mit ihrem Übermass an Anstrengungen und Strapazen eine vorübergehende [Hervorhebung im Original] Herzmuskelschwäche sowie eine starke Reduzierung des Allgemeinzustandes mit Schwächezustände bestanden“ hatte. Unter Berücksichtigung des Verlusts des rechten Auges wurde ihm 1955 schlussendlich eine Erwerbsminderung von 50 Prozent zugestanden. Weiterhin wurde als erwiesen angesehen, dass Bruno Splitts „soziale und wirtschaftliche Stellung“ in der Vorkriegszeit der eines „mittleren Beamten“ entsprach. Diese wurde der Bemessung seiner Rentenhöhe zugrunde gelegt. Mit dieser individuellen Entschädigungsleistung wurde angestrebt die durch die „Verfolgung beschädigte Biographien und soziale Positionen in gewissen Umfang zu restaurieren.“ Darüber hinaus erhielt er eine „Geldentschädigung für Freiheitsentziehung“ von 19 200 DM. Das Verfahren endete im März 1957 mit der Anpassung an die Bestimmungen des am 29. Juni 1956 erlassenen „Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung“ (BEG).
In der Nachkriegszeit wurde Bruno Splitt mehrfach im Vorfeld diverser juristischer Verfahren gegen verschiedene SS-Angehörige zu seiner Haftzeit in Sachsenhausen befragt. Im August 1961 geschah dies im Zuge laufender Ermittlungen gegen SS-Scharführer Otto Kaiser (1913-1996) und Friedrich Meyerhoff (1916-1987). Beide waren Block- und Kommandoführer in Sachsenhausen. Gegen Meyerhoff lief ab 1959 in Köln ein Verfahren wegen dessen Beteiligung an der Ermordung sowjetischer Kriegsgefangener. Die Ermittlungen mündeten 1964 zu einem ersten Sachsenhausen-Prozess gegen die beiden genannten Täter. Zu den Beschuldigungen gegen die beiden konnte Splitt aber keine weiteren Angaben machen. In einer zweiten Zeugenvernehmung am 13. Oktober 1968 wurde Splitt über den Lagerarzt Dr. Ludwig Ehrsam befragt. Splitt gab an, dass er sich lediglich an dessen Namen erinnern könnte, aber Genaueres könne er nicht berichten. Diese Zurückhaltung ist bemerkenswert, da Ehrsam, der zunächst SS-Arzt zunächst in Dachau und dann in Sachsenhausen gewesen war, für seine besonders brutale und inhumane Behandlung der Häftlinge unter dem Namen Dr. Grausam bekannt geworden ist. Zu den Verbrechen, die im Zusammenhang mit dem Schuhläuferkommando begangen wurden, konnte Splitt ebenfalls nichts zu Protokoll geben. Die Angehörigen des SS-Kommandanturstabs stellten sich den Häftlingen gewöhnlich nicht namentlich vor, sodass die Namen von den Häftlingen untereinander weitergegeben wurden. Dies führte verständlicherweise auch oft zu Verwechslungen und erschwerte die Zuordnung der begangenen Gräueltaten in der juristischen Aufarbeitung in der Nachkriegszeit oft erheblich.
Wie Bruno Splitt seine letzten Lebensjahre verbrachte ist ungewiss. Eine neue Ehe ging er nicht ein und Kinder hatte keine. Ob er sich in der Nachkriegszeit erneut politisch betätigt, ist ebenso nicht bekannt. Es ließen sich keine Genoss*innen ausfindig machen, die ihn persönlich gekannt haben und etwas hätten berichten können. Vielleicht hat er sich ins Private zurückgezogen, um seine Ansprüche im Wiedergutmachungsverfahren nicht zu gefährden. Ebenso erscheint es möglich, dass er mit seiner Vergangenheit abschließen wollte. Bruno Splitt starb am 21. April 1981 in Hof.
Repères
Localisations
Nationalités
- Allemand (1898 - 1981)
- Allemand (1898 - 1981)
Confessions
Publications
Références